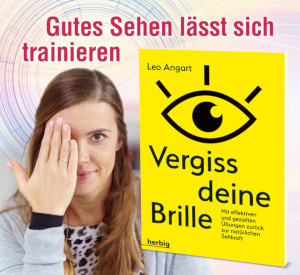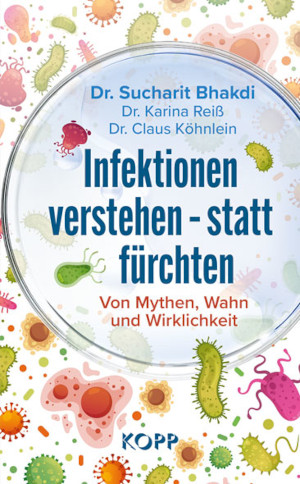Von Augsburg aus schmieden die Fugger um 1500 einen Konzern, der mit Fernhandel, Bergbau und Geldgeschäften ein gewaltiges Vermögen anhäuft. Ihr Geschäftssinn trägt den deutschen Kaufleuten Einfluss ein. Und Hass.
von Markus Wolff
Genug! Seine Geduld ist erschöpft. Seit zwei Tagen schon versucht Kardinal Thomas Cajetan mäßigend auf diesen störrischen Mönch einzuwirken, mit dem sich aber nicht reden, nur streiten lässt. Vehement und lautstark. Sieht der Augustinerbruder denn nicht, dass die Herausforderungen der Zeit nach Einheit verlangen?
Im Osten stehen die osmanischen Heere an der ungarischen Grenze, anscheinend jederzeit bereit, einen weiteren Schlag gegen die Reiche der Christenheit zu führen. Und ausgerechnet jetzt, so mag es dem päpstlichen Gesandten durch den Kopf gehen, kommt dieser Martin Luther, kritisiert den käuflichen Sündenerlass, wiegelt die Gläubigen gegen den Heiligen Vater auf und droht mit seinen Ansichten die Kirche zu spalten, ja gar die Gesellschaft auseinanderzureißen. “Geh und komme mir nicht mehr unter die Augen”, befiehlt Cajetan schließlich.
Am 14. Oktober 1518 verlässt Martin Luther zum letzten Mal den palastartigen Komplex am Augsburger Weinmarkt, in den ihn die Kurie zur Anhörung zitiert hat. Es ist ein prächtiger, kupferbedeckter Bau, mit Gewölbesäulen aus Marmor, hölzernen Kassettendecken und Tapisserien.Hinter einer fast 70 Meter langen, mit historischen Motiven bemalten Schaufassade liegen drei Innenhöfe, den schönsten zieren Arkaden mit Fresken. Demonstrativ unterstreichen viele der Darstellungen die Treue des Hausherrn zum römisch-deutschen Kaiser Maximilian und rühmen die Taten des Herrschers, der bei seinen Besuchen der Stadt häufig hier zu Gast gewesen ist: im Hauptsitz der Fugger.
Innerhalb von nur drei Generationen ist der Familie ein beispielloser Aufstieg gelungen, von einfachen Webern zum dominierenden Handelskonzern ihrer Zeit. Der Name Fugger, das heißt Warenhandel, Bergbau, Geldgeschäfte überall in Europa. Der Einfluss der Fugger beflügelt oder beendet Karrieren, ihre Kredite entscheiden über Krieg und Frieden. Sie gehören zu den wichtigsten Finanziers und Geschäftspartnern des Papstes. Und ihr Geld bringt Herrscher auf den Thron: Mehr als 500 000 Gulden zahlen sie unter anderem jenen Fürsten, die nach dem Tod Kaiser Maximilians seinem Enkel Karl V. zur Krone verhelfen – eine Summe, die mehr als einer Tonne Gold entspricht.
Wohl nie zuvor und nie wieder danach hat ein einzelnes Unternehmen in Europa eine vergleichbare Machtfülle und Bedeutung erreicht. An seiner Spitze steht ein früh über seiner Arbeit gealterter Mann, bekannt für seinen eisernen Führungsstil. Mit ebenso schlauer wie aggressiver Firmenpolitik hat Jakob Fugger den Familienbetrieb zu einem der ersten multinationalen Konzerne der Geschichte geschmiedet – und ist dabei selbst zum wohlhabendsten Mann seiner Zeit geworden.

Beim Verhör Martin Luthers ist der 59-Jährige nicht anwesend – und doch allgegenwärtig. Denn ein großer Teil von Luthers Kritik richtet sich ja genau gegen Menschen wie diesen neu entstandenen Typ eines Unternehmers und päpstlichen Verbündeten; sowie gegen Firmen, die mit kirchlichem Segen den Glauben zum Geschäft gemacht haben und an Ablässen und Reliquien verdienen.
Die genauen Zusammenhänge kennt der Doktor der Theologie vermutlich nicht. Aber der in der Fugger-Zentrale zur Schau gestellte Prunk der Kaufleute mag ihn in seiner Vermutung bestätigen, dass die dafür nötigen Gewinne nicht ehrlich erzielt worden sein können. Und so notiert Luther empört: “Wie sollte das immer mögen göttlich und gerecht zugehen, dass ein Mann in so kurzer Zeit so reich werde, dass er Könige und Kaiser auskaufen möge?”
Die Fugger nutzen die Gier der Fürsten
Augsburg, etwa 150 Jahre zuvor. Langsam erholt sich die Stadt von den Folgen der Pest. Die Einwohnerzahl nimmt zu. In der Hoffnung auf bessere Einkünfte und ein Leben ohne Frondienst und Lehnsherren verlassen viele Handwerker, Bauern und Knechte ihre Dörfer. Stadtluft macht frei, lautet ihr Leitsatz, der einem alten Rechtsbrauch entspringt: In die Stadt gezogene abhängige Bauern konnten nach “Jahr und Tag” nicht mehr von ihren Herren zurückgefordert werden.
Zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor entwickelt sich in Augsburg das Textilgewerbe, und so tritt 1367 ein junger Landweber durch das Tor der Stadt. Er kommt aus Graben, einer Ortschaft kaum 30 Kilometer südlich. Ein nüchterner Eintrag im Steuerbuch – “Fucker advenit” – vermerkt die Ankunft dieses Hans Fugger. Und markiert den Beginn einer furiosen Erfolgsgeschichte.
Hans Fugger heiratet zweimal, jeweils die Tochter eines Weberzunftmeisters, er erhält die Bürgerrechte, und sein soziales Ansehen steigt ebenso wie sein Vermögen. Vermutlich lässt er im Laufe der Zeit auch andere Weber für sich arbeiten, wird Unternehmer und Kaufmann. 30 Jahre nach seiner Ankunft in Augsburg liegt er unter den 2930 Steuerzahlern der Stadt bereits an 41. Stelle. Als er um 1408 stirbt, hinterlässt Hans Fugger seiner Witwe und seinen beiden Söhnen ein respektables Erbe. Seine Nachkommen, Andreas und Jakob, sind ebenfalls gute Kaufleute. Sie arbeiten nun auch im Fernhandel, verkaufen die günstig gefertigten Tücher heimischer Landweber mit gutem Gewinn in Frankfurt, Innsbruck, Venedig. Doch das eher bescheidene Wesen des einen verträgt sich auf Dauer nicht mit der geltungsbedürftigen Art des anderen. Schließlich trennen sich die Geschwister. Der stets teuer gekleidete Andreas begründet die Linie der Fugger vom Reh, die sein zuweilen hochmütiger Sohn Lukas mit Warenhandel und Finanzgeschäften zu ungeahnter Blüte führt – und schließlich durch einen Kredit, dessen hochgeborener Empfänger und auch dessen Bürgen nicht zahlen, in den Bankrott.

Eine bemerkenswerte Karriere gelingt danach keinem der Fugger vom Reh mehr. Fortan müssen sie ihr Geld als Kürschner, Schriftkünstler oder Trompeter verdienen. Anders ergeht es Jakobs Familie. Mit Fleiß, Beharrlichkeit und möglichst risikoarmen Geschäften wird ihr Oberhaupt mit dem derben Gesicht und der knollenhaften Nase zum siebtreichsten Bürger der Stadt. Vom Schritt zur vermögendsten Familie Europas trennt die Fugger von der Lilie nur noch eine Generation. Dabei ist der Abstand zu den wahrhaft Reichen ihrer Zeit immer noch enorm: Cosimo de’ Medici in Florenz etwa verfügt um die gleiche Zeit über mehr als das 35-fache Kapital. Jakob der Ältere zeugt sieben Söhne, von denen die meisten im Geschäft des Vaters arbeiten – aber nicht alle: So ist das 1459 geborene zehnte Kind, das auch den Namen Jakob trägt, möglicherweise zunächst für eine Kirchenlaufbahn vorgesehen – jener Junge, der zum wohl erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten aufsteigen wird.
Zwei seiner sechs Brüder – Ulrich und Georg – führen einstweilen in Augsburg und in den anderen Niederlassungen der Firma den Handel mit Gewürzen und Textilien. Dank guter Geschäfte und wirtschaftlich attraktiver Eheschließungen sammelt sich nach und nach ein beachtliches Vermögen an. Schließlich wird sogar der römisch-deutsche Kaiser, ein Habsburger, auf die Kaufmannsfamilie aufmerksam.
Das Haus Habsburg ist zu jener Zeit eine europäische Großmacht: Es herrscht unter anderem über das Erzherzogtum Österreich, Tirol und die Steiermark – und stellt den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch leidet der derzeitige Regent, Friedrich III., unter chronischen Geldsorgen: Seine ehrgeizigen Expansionspläne stehen im Missverhältnis zu seinen finanziellen Möglichkeiten.
Für jedermann ersichtlich wird seine Not im April 1473, als der kaiserliche Zug in Augsburg haltmacht. Friedrich ist unterwegs nach Trier, um die Vermählung seines einzigen Sohns Maximilian mit Maria von Burgund in die Wege zu leiten: der Tochter und Alleinerbin des reichen Herzogs Karl des Kühnen. Friedrich kann in der Heimatstadt der Fugger nicht einmal seine Schulden bei Metzgern, Bäckern und Handwerkern begleichen. So wenig Autorität besitzt der Herrscher, dass schließlich gar ein Hufschmied dessen Pferden in die Zügel greift, um die kaiserlichen Kutschen an der Abfahrt zu hindern – vermutlich hat der Kaiser auch bei ihm seine Rechnung nicht bezahlt. Erst als die Stadt dem hochgestellten Schuldner Geld leiht, kann der Tross weiterziehen. Nun allerdings deutlich anders, als er gekommen ist: festlich gekleidet.
Finanziert worden ist die Garderobe von Ulrich Fugger, der dem Kaiser auf seiner Suche nach kreditwilligen Kaufleuten als “redlicher und habhafter Mann” empfohlen worden ist. Vermutlich ahnt der Firmenchef, dass man ihm die Stoffe niemals bezahlen, sich die Geste aber lohnen wird. So kommt es auch. Zwei Monate später erhält die Familie vom Kaiser das auf Pergament verbriefte Recht, ein eigenes Wappen zu führen – zwei Lilien in einem gespaltenen Schild. Weitaus entscheidender aber: Damit ist die Allianz zwischen Habsburgern und Fuggern begründet. Die Hilfe in misslicher Lage wird das Herrscherhaus den Augsburgern nie vergessen.
Wohl noch 1473 tritt Jakob der Jüngere mit 14 Jahren in die Firma ein, die nun nicht nur in den deutschen Landen und Italien, sondern auch in Polen und vermutlich hinauf bis Skandinavien Handel treibt. Mitzureden hat der Neuling im Unternehmen zunächst wenig, die Führung bleibt in den Händen des fast zwei Jahrzehnte älteren Ulrich.
Zur kaufmännischen Ausbildung reist Jakob zu deutschen Geschäftsleuten nach Venedig. Nirgendwo lässt sich Wirtschaft eindrucksvoller und anschaulicher studieren als in der Lagunenstadt, wohin die Händler neben Gewürzen und Tuchen auch Nachrichten aus vielen Teilen der Welt mitbringen. Das Straßenbild bestimmen außer den stolzen Venezianern schwarze Sklaven, osmanische Diplomaten, Araber, Griechen. Hier gibt es bereits Patentschutz, Seeversicherungen und Pilgerreisen im Pauschalangebot.

Der wortkarge Fugger versteht die für ihn wesentlichen Grundprinzipien des Handels schnell. Er erkennt, dass erfolgreiches Geschäftemachen nicht nur vom Produkt abhängt, sondern Täuschungen und List genauso erfordert wie ein gut gewobenes Netz aus Beziehungen und Fürsprechern. Eine venezianische Kappe, die er in späteren Jahren zumeist trägt, drückt das Selbstverständnis aus, dass sein Kaufmannsdenken nicht mehr durch Grenzen von Ländern beschränkt ist. 1479 kehrt Jakob Fugger nach Augsburg zurück, entwickelt sich zur kenntnisreichen Hilfe in der Firma, die nach wie vor eher mit Vorsicht als mit Risikofreude geleitet wird. Das wird sich ändern.
Betreiben die Fugger bis dahin nur Warenhandel und kleinere Geldtransaktionen, so engagieren sie sich in den 1480er Jahren auch im Metallgeschäft. In Tirol, wo die ertragreichsten Silberminen Europas liegen, wendet die Firma erstmals eine jener Geschäftspraktiken an, die für sie charakteristisch werden: Sie nutzt den Geltungsdrang, die Maßlosigkeit und die wirtschaftliche Unfähigkeit vieler Fürsten aus – in diesem Fall des Habsburgers Siegmund, des Landesherrn von Tirol.
Obwohl “der Münzreiche”, wie ihn seine Zeitgenossen nennen, über ein an Bodenschätzen wohlhabendes Land gebietet, ist Siegmund vor allem wegen seines verschwenderischen Hoflebens auf ständiger Suche nach Kreditgebern. Daher gefallen ihm 1485 die Konditionen eines ersten kleinen Fugger-Darlehens über 3000 Gulden. Denn statt das Geld verzinst zurückzahlen zu müssen, soll er den Betrag mit Silberlieferungen tilgen. Siegmund besitzt ein Vorkaufsrecht zu vergünstigtem Preis für das in seinem Land geförderte Edelmetall. Dieses Vorkaufsrecht tritt er nun an die Augsburger ab, die das Silber ins Ausland verkaufen – sowie mit Gewinn zurück an die Tiroler Behörden.

Bald werden die Fugger zum entscheidenden Kreditgeber des Habsburgers. Nach zahlreichen weiteren Darlehen erzielen sie in den folgenden Jahren aus den Geschäften in Tirol einen geschätzten Gewinn von 400 000 Gulden – mehr als das Hundertfache des ursprünglichen Kredits. Nachdem Siegmund zur Finanzierung seiner Hofhaltung und eines Krieges gegen Venedig seine Einnahmen aus der Edelmetallförderung beinahe vollständig verpfändet hat, muss er 1490 auf Drängen des einheimischen Adels zurücktreten – ein Umsturz, auf den der vorausschauende, mit den Tiroler Geschäften betraute Jakob Fugger wahrscheinlich eigens hingearbeitet hat. Er verspricht sich von Siegmunds Nachfolger eine noch intensivere Zusammenarbeit und noch einträglichere Geschäfte: Denn die Herrschaft in Tirol übernimmt nun Maximilian, der Sohn von Kaiser Friedrich III.
Ihr Geld macht Kaiser
Wie sein Vater, der den Fuggern einst ihr Wappen verlieh, ist auch Maximilian den Kaufleuten wohlgesonnen. Der neue Landesherr steht für Siegmunds Schulden ein – und wird selbst zu einem der besten Kunden der Augsburger. 1491 nimmt Maximilian ein Darlehen über 120 000 Gulden bei den Fuggern auf, die dafür weiterhin mit dem Silber der Tiroler Berge entlohnt werden.
Markt bestimmen. Er hat erreicht, was er wollte: eine monopolartige Stellung. Bis 1525 wird das Kupfergeschäft insgesamt einen Gewinn von mehr als 1,5 Millionen Gulden einbringen. Solche Praktiken sind es, die Martin Luther anprangern wird. Der Wittenberger sieht vor allem im Streben der großen Handelsgesellschaften nach Monopolen die Ursache für Preissteigerung und die Armut der Bevölkerung. Innerhalb weniger Jahre überziehen die Fugger Ungarn, sowie zahlreiche andere Länder, mit einem Netz aus Niederlassungen, über das die “Faktoren”, die Leiter der Handelsniederlassungen, das Metallgeschäft organisieren. Wo die Transportwege den Ansprüchen der Fugger nicht genügen, lassen sie auf eigene Kosten Straßen bauen.
Ihre von Sevilla bis Danzig eingesetzten und gut bezahlten Faktoren bilden fortan das RFür Maximilian, der 1493 seinem Vater als Reichsoberhaupt nachfolgt, werden die Augsburger zu den wichtigsten Finanziers, zur unverzichtbaren Stütze seines Throns. Mit ihren Vorschüssen und Darlehen bezahlt er Diener und Staatsbeamte, begleicht Rechnungen für Handwerker und Lieferanten, für Hochzeitsvorbereitungen und Feldzüge. Das Geld der Fugger finanziert häufig auch die aufwendigen, sich oft über mehrere Monate erstreckenden Reichstage: jene Versammlungen der Fürsten und Städtevertreter des Reichs, auf denen nicht selten die Verflechtungen des Regenten mit seinen wichtigsten Geldgebern angeprangert werden.
Augsburg wird zum bedeutendsten Handelszentrum Mitteleuropas
Dennoch lässt sich Maximilian nicht davon abhalten, immer wieder in die Stadt seiner Finanziers zu reisen – so häufig, dass ihn der König von Frankreich spöttisch “Bürgermeister von Augsburg” nennt. Offenbar empfindet der Monarch die Abhängigkeit von seinen schwäbischen Kreditgebern keineswegs als bedrückend und genießt die Gastmähler in den Fugger-Häusern im Zentrum Augsburgs.
Mit etwa 25 000 Einwohnern hat sich die Stadt mittlerweile zum bedeutendsten Handelszentrum Mitteleuropas entwickelt, in dem immer wieder Künstler und Gelehrte absteigen, Kurfürsten und hohe Geistliche. Häufig sind sie Gäste des Konzerns, als dessen Kopf inzwischen Jakob Fugger gilt. Mit Mut und Entschlossenheit hat er seine beiden eher zögerlichen Brüder Ulrich und Georg von der Spitze verdrängt. Auch wenn der Älteste zunächst noch Namensgeber der Firma “Ulrich Fugger und Gebrüder von Augsburg” bleibt, führen Behörden das Unternehmen oft schon als “Jakob Fuggers Gesellschaft”.
Längst ist bekannt, dass der früh ergraute Mann mit dem kantigen Schädel die Strategie des Konzerns bestimmt: ein Genie, das schnell abzuwägen, zu entscheiden und zu handeln vermag, ausgestattet mit scharfem Blick für Chancen und Geschäfte, zudem bereit zu jedem Trick und jeder erforderlichen Härte. (Noch am Sterbebett eines langjährigen engen Mitarbeiters etwa fordert er 800 Gulden ein, die dieser dem Unternehmen schuldet.) Ein Meister der Beziehungspflege ist er obendrein. Jakob Fugger versteht es, Menschen durch Gefälligkeiten an seine Firma zu binden oder durch kostbare Geschenke zu fast jeder gewünschten Meinungsänderung zu bewegen. Immer wieder verblüfft er Gegner wie Verbündete mit brillanten taktischen Zügen, so auch beim Einstieg in das Kupfergeschäft, das sich schnell zu einer weiteren ertragreichen Säule des Fugger-Imperiums entwickelt.
Der Handel mit dem weichen, zähen Metall verspricht Anfang der 1490er Jahre gute Gewinne, da es nicht mehr nur für Töpfe oder Krüge, sondern auch für die Herstellung von Waffen benötigt wird. Lukrativ erscheinen Jakob vor allem die ungarischen Minen (auf dem Gebiet der heutigen Slowakei), die einst aufgegeben wurden, noch ehe sie vollständig ausgebeutet worden waren.
Um seine Pläne vor seinen Konkurrenten zunächst geheim zu halten, kauft ein angesehener polnischer Bergbauingenieur in Fuggers Auftrag Grube um Grube auf. Dank seiner Sachkenntnis gelingt es Jakobs Geschäftspartner schon bald, die vernachlässigten Minen in ertragreiche Betriebe zu verwandeln.
Als der Marktpreis des Kupfers aufgrund des zusätzlichen Angebots zu sinken beginnt, schließen sich die Tiroler Metallhändler zum vermutlich ersten Kupfersyndikat der Geschichte zusammen; auch die Fugger mit ihren Tiroler Betrieben beteiligen sich daran. Die Augsburger bieten sogar an, den gemeinschaftlichen Vertrieb des Buntmetalls in Venedig zu organisieren. Doch kaum steht die Tiroler Ware in der Lagunenstadt zum Verkauf, unterbieten die Fugger über einen Strohmann den Preis – mit großen Mengen ihres ungarischen Kupfers. Das geschieht so lange, bis sich das unverkäufliche Kupfer des Syndikats in den Lagerhäusern türmt. Es droht der Bankrott, das Syndikat zerbricht.
Jakob kann nun mit dem Kupfer aus den ungarischen und aus seinen übrigen Minen den ückgrat des Konzerns. Sie stehen jeweils einer Außenstelle vor – einer Kombination aus Warenlager, Büro, Postamt und Handelshof. Meist herrscht dort nüchterne Arbeitsatmosphäre, doch in bedeutenden Städten wie Antwerpen, Neapel oder Rom, wo die Faktoreien den Wohlstand ihrer Firma repräsentieren müssen, sind die Räume mit Wandteppichen, Silbergeschirr, später auch mit goldverzierten Ledersesseln eingerichtet.
Wer als Faktor einer Niederlassung vorsteht, ist gut ausgebildet, kennt sich aus in Sprachen, Recht, Buchhaltung. Die Pflichten zu Verschwiegenheit oder genauer Buchführung regeln meist befristete Arbeitsverträge, die vorzeitig nur von der Firma zu kündigen sind. Als Gegenleistung führt der Faktor ein privilegiertes Leben: Hans Metzler etwa, Leiter der Fugger-Niederlassung in der ungarischen Bergbaustadt Neusohl (heute Banská Bystrica in der Slowakei), erhält mit 400 Gulden rund doppelt so viel Lohn wie ein Professor. Obendrein genießt er Sondervergütungen bei besonderen Leistungen, Geschenke, kostenlose Mahlzeiten, und er darf mietfrei wohnen. Umgekehrt müssen nicht wenige Faktoren mobil sein, da sie die Fugger im Lauf der Jahre an oft mehreren, weit auseinanderliegenden Orten vertreten.

Die Zentrale des Konzerns bleibt in Augsburg, wo in der “Goldenen Schreibstube” – einem kostbar verzierten Raum mit vergittertem Erker – die Informationen über jeden Handel, jeden Herrscherwechsel, jeden neuen Kriegszug verwertet werden. Details über die genauen Geschäftspraktiken aber gelangen nicht nach außen, Diskretion gehört zu den wichtigsten Firmenprinzipien. So erfährt auch niemand, dass die Fugger selbst Kredite aufnehmen müssen, um vor allem Maximilians ständigen Geldhunger stillen zu können. Bereits 1486 wird ihre Firma vom Augsburger Rat erstmals als “Bank” bezeichnet, denn die Fugger arbeiten auch mit den Einlagen wohlhabender Bürger. Hochrangige Geistliche vertrauen ihnen zur Vermehrung ihres privaten Vermögens ebenfalls Geld an, heimlich, und umgehen so – zur späteren Empörung Luthers – das kirchenrechtliche Zinsverbot, das Gewinne aus Leihgeschäften untersagt.
Zum wichtigsten Finanzier des Fugger-Unternehmens wird der Brixener Fürstbischof Melchior von Meckau, dessen immense Einlage schließlich etwa drei Viertel des Grundkapitals der Firma ausmacht und fast zu deren Zusammenbruch führt. Denn als Melchior 1509 ohne ein rechtsgültiges Testament stirbt, finden sich in den Ärmeln seines Gewandes Quittungen über etwa 300 000 Gulden, auf die nun der Papst als vermeintlicher Erbe des Bischofs Anspruch erhebt. Doch der vom Pontifex vermutlich beabsichtigte sofortige Abfluss des Geldes aus der Firma würde deren Ruin bedeuten.
Jakob Fugger taktiert, bemüht einflussreiche Fürsprecher. Schließlich setzt sich sogar Maximilian beim Papst ein. Durch geschickt lancierte Andeutungen hat der Kaiser vernommen, dass sein Augsburger Bankier “jählings nicht bei Gelde” sei. Da er den unverzichtbaren Kreditgeber nicht verlieren möchte, vermittelt er zwischen Fugger und dem Heiligen Vater, der sich am Ende offenbar mit einer einmaligen Zahlung zufriedengibt – und den Rest des Erbes von Bischof Melchior dem Kaiser überlässt.
Noch mehrfach werden später zwar kleinere Raten und Beträge ausbezahlt, der größte Teil des Erbes verbleibt jedoch als Einlage in der Firma. Die schwerste Krise in der Geschichte des Konzerns ist überstanden. Nie wieder lässt es der oberste Fugger danach zu, dass einzelne stille Teilhaber eine ähnliche Bedeutung für sein Unternehmen erlangen wie Melchior von Meckau.
Der Fürstbischof mag zwar der kapitalschwerste Geistliche in der Kundenkartei der Augsburger sein – aber er ist keineswegs der höchstrangige. Denn ganz offiziell nimmt sogar der Papst bereits seit 1476 die Dienste der Fugger in Anspruch.
Anfangs leiten die Kaufleute über ihr gut ausgebautes Faktoreinetz vorwiegend der Kurie zustehende Gebühren aus verschiedenen Regionen und Bistümern weiter. Doch im Lauf der Zeit sorgen Zuverlässigkeit und Effizienz der Fugger dafür, dass ihre Aufgaben immer umfangreicher werden. Vor allem der umtriebige und skrupellose römische Faktor Johannes Zink – der sich persönlich das Einkommen aus 32 Kirchenämtern verschafft, ohne diese je auszuüben – vergrößert den Einfluss der Augsburger. Bald prägen die Fugger auch die päpstlichen Münzen und versorgen den Kirchenstaat mit Kupfer und Zinn. Schließlich steigen sie auf zum Kreditgeber der Kurie und organisieren sogar die Truppen für den Vatikan: Die Soldaten der “Schweizergarde” (die bis heute mit Kürass und Hellebarde den Papst schützt) erhalten bei ihrem Eintreffen in der Ewigen Stadt im Januar 1506 ihren ersten Sold aus der Kasse der Fugger.
Ablasshandel – das Geschäft mit der Sünde
Richtig profitabel wird das Geschäft mit dem Papst für die Augsburger aber erst durch den Handel mit Ablassbriefen. Für die Kirche sind die Briefe, durch deren Kauf die Gläubigen angeblich ihre Leidenszeit im Fegefeuer verkürzen können, eine lukrative Geldquelle. Mit dem Ertrag daraus finanzieren die Päpste nicht nur den eigenen opulenten Lebensstil, sie decken damit auch die Kosten für Kriegszüge oder neue Kirchen und Spitäler. Gegen eine angemessene Beteiligung übernehmen die Fugger die Organisation dieses Geschäfts und garantieren der Kurie den Erhalt der ihr zustehenden Beträge.
An solchen Geschäften aber entzündet sich schließlich die Kritik des Augustinermönchs Martin Luther – und vor allem an einem Ablass aus dem Jahr 1515, von dem die Fugger mehr als üblich profitieren. Es geht um eine Absprache mit Albrecht von Brandenburg, einem jungen, ehrgeizigen Geistlichen, der bereits mit 23 Jahren zum Erzbischof von Magdeburg gekürt worden ist. Ein Jahr später will er sich den gleichen Titel auch in Mainz sichern, dem größten Erzbistum der damaligen Christenheit: ein Posten, der Albrecht zum Erzkanzler machen würde – zum nach dem Kaiser höchstrangigen Fürsten im Heiligen Römischen Reich.
Doch die Bündelung zweier lukrativer Ämter widerspricht dem Kirchenrecht – und ist nicht günstig zu haben: Die Zahlungen Albrechts an die Kurie sowie Schmiergelder, Botenlöhne und sonstige Kosten verschlingen mehr als 48 000 Gulden, die dem Geistlichen von den Fuggern vorgestreckt werden. Niemand kann heute mehr sagen, wer die passende Idee für die Tilgung der Schulden hat. Nur so viel ist klar: 1515 schreibt Papst Leo X. einen acht Jahre lang gültigen Ablass aus, an dessen Einnahmen Albrecht von Brandenburg zur Hälfte beteiligt sein soll; der für den Papst bestimmte Teil ist für den Bau des Petersdoms gedacht. Der Gewinn wird auf etwa 73 000 Gulden veranschlagt, also fast das Doppelte der benötigten Summe.
Bald darauf ziehen die Ablassprediger übers Land, begleitet jeweils von einem Angestellten der Fugger, der Buch führt über das eingenommene Geld. Zum bekanntesten dieser Prediger wird der hochgewachsene Dominikaner Johann Tetzel, ein ehemaliger Inquisitor, der in seinen Reden verkündet, der Ablass könne sogar das Heil Verstorbener retten. Dieser moralische Verfall der Kirche bringt den Fuggern enorme Profite – und ebnet der Reformation den Weg. Denn in seinen 95 Thesen klagt Martin Luther am 31. Oktober 1517 die Auswüchse und Geschäftetreiberei mit dem Glauben an. Schon im Jahr darauf wird er für seine Kritik nach Augsburg zitiert, wo er vom päpstlichen Kardinallegaten Thomas Cajetan befragt wird – im Anwesen von Jakob Fugger.
Unbekannt ist, ob der Mönch während des zweitägigen Verhörs auch auf den Hausherrn trifft, dessen Geschäfte er bedroht. Denn der theologische Streit – die Frage also, wieso der Papst Ablässe nicht aus Liebe verschenkt, sondern Sündenstrafen gegen Geld erlässt – ist Fugger eher gleichgültig. Sein Interesse gilt dem Gewinn. Der bleibt bei diesem Ablass weit hinter den Erwartungen zurück, vor allem wegen hoher Personalkosten; allein Tetzel rechnet pro Monat für sich und seine Unterkommissare 300 Gulden ab. Und halten die Störungen durch diesen Luther an, wer weiß, vielleicht schädigen sie dauerhaft das Ablassgeschäft.
Was den Unternehmer Jakob Fugger bei seinem unermüdlichen Schaffen antreibt, bleibt im Unklaren. Der Wunsch nach einem luxuriösen, gar ausschweifenden Leben kann jedenfalls nicht der Grund für sein ewiges Streben sein. Jakob Fugger bleibt Zeit seines Lebens privat ein bescheidender Mann: Bis 1497 hebt er im Durchschnitt monatlich 19 Gulden ab; später, als er mehr repräsentative Pflichten wahrnehmen muss, sind es 225. (Das kurz nach seinem Tod bilanzierte Gesellschaftsvermögen beträgt mehr als zwei Millionen Gulden.)
Mit geradezu diktatorischer Konsequenz führt er den Stab seiner Mitarbeiter, zu denen er aber auch milde und großzügig sein kann. Technische Innovationen oder neue Chancen, die sich aus der Struktur seines Unternehmens ergeben, vermag er raffiniert zu nutzen. So fasst er etwa die in der Goldenen Schreibstube eintreffenden Nachrichten zu “Kaufmannsbriefen” für seine Kunden zusammen, einem Vorläufer der modernen Zeitung.
Man müsste wirklich dem Fugger einen Zaum ins Maul legen
So revolutionär und unkonventionell seine Methoden als Kaufmann sind, so konservativ ist der Mensch Jakob Fugger: Er glaubt an Loyalität gegenüber seinem Kaiser, gründet mit der “Fuggerei” in Augsburg die älteste noch heute bestehende Sozialsiedlung der Welt, gilt als tief religiös, streng katholisch, kauft sogar selbst Ablässe. Bezieht auch im Bauernkrieg Stellung: Fugger bewilligt Geld zur Niederschlagung von Aufständen der Landleute und finanziert Truppen für Kämpfe in Schwaben und Tirol.
Den wahren Urheber von Krieg und Verwüstungen sieht der strikte Gegner der Reformation in Luther, der wohl gern ungeschehen machen würde, so Fugger, was er angerichtet habe – dafür jedoch sei es nun zu spät. Nichts kann die Reformation aufhalten. Jakob Fugger setzt aber alles daran, zu verhindern, dass neben dem alten Glauben und der alten Welt auch noch sein Imperium ins Wanken gerät.
Ab 1520, inzwischen über 60 Jahre alt, fühlt der kinderlose Augsburger allmählich seine Kräfte schwinden. Er braucht einen Nachfolger, der die Firma nach seinem Tod mit dem gleichen Weitblick und derselben Härte zu führen vermag – und findet ihn schließlich in seinem Neffen Anton, unter dem das Unternehmen dereinst seine größte Ausdehnung erleben wird. Jakob kämpft bis zuletzt um bestmögliche Gewinne. “Man müsste wirklich dem Fugger und dergleichen Gesellschaft einen Zaum ins Maul legen”, fordert Martin Luther.
Doch was weder Kaiser noch Reformator vermögen, das gelingt dem Tod. Ab dem Herbst 1525 verschlimmert sich der Gesundheitszustand des Firmenchefs rapide. Vom Arbeiten will Fugger nicht lassen, aber die Nachricht von seinem Zustand verbreitet sich schnell. Statt wie üblich mit Musik, lässt Erzherzog Ferdinand, Bruder Kaiser Karls V. und dereinst dessen Nachfolger, bei seinem Einzug in Augsburg den Tross schweigend am Haus des Kranken vorüberziehen. Am 28. Dezember diktiert Jakob Fugger den letzten von mehreren Tausend Briefen, die er in seinem Leben verfasst hat. Zwei Tage später, am 30. Dezember 1525, schließt der reichste Mann seiner Zeit im Morgengrauen für immer die Augen. Während sich die Verwandten in Fluren und Gängen in der Nähe aufhalten, sind an seiner Seite nur ein Priester und eine alte Magd.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 64.500 Euro!
Um auch 2025 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 64.500 von 125.000 Euro. In einer normalen Woche besuchen im Schnitt rund 250.000 Menschen unsere Internetseite. Würde nur ein kleiner Teil von ihnen einmalig ein paar Euro spenden, hätten wir unser Ziel innerhalb kürzester Zeit erreicht. Wir bitten Sie deshalb um Spenden in einer für Sie tragbaren Höhe. Nicht als Anerkennung für erbrachte Leistungen. Ihre Spende ist eine Investition in die Zukunft. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für unsere Arbeit und unterstützen Sie ehrlichen Qualitätsjournalismus jetzt mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: