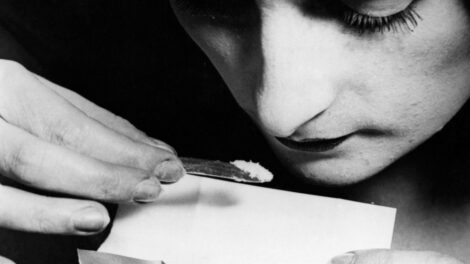Er schlug die Moslems und die Langobarden. Weder Aufstände noch militärische Rückschläge halten den Aufstieg jenes Frankenherrschers auf, der als Karl der Große in die Geschichte eingehen wird. Stetig erweitert er die Grenzen seines Reiches, schmiedet Bündnisse und verwirft sie, wenn sie ihm nicht mehr nützen. Seinen Aufstieg krönt er im Jahr 800 mit einem sagenhaften Titel.
von Cay Rademacher
Der König der Franken spürt die Gefahr nicht, in die er seine Kämpfer führt. Karl aus dem Geschlecht der Karolinger, ein hochgewachsener Mann um die 30, ahnt nicht, dass in den Wäldern an den Hängen oberhalb des Bergpfads der Feind bereits lauert. Wie viele Augen mögen es sein, die an diesem Augusttag des Jahres 778 das fränkische Heer auf seinem Heimweg durch die Pyrenäen beobachten? Niemand kann es heute noch sagen. Eines aber ist sicher: Die verborgenen Krieger wollen sich rächen.
Den Ort für ihren Hinterhalt, den Pass von Roncesvalles, der rund 35 Kilometer nordöstlich von Pamplona über das Gebirge führt, haben sie gut gewählt. Auf schmalen Wegen zieht sich hier die gegnerische Kolonne noch mehr in die Länge als sonst. Während sich ihre Spitze wohl schon dem Scheitelpunkt des Gebirgsübergangs nähert, marschiert die Masse von Karls Männern noch durch das zerklüftete, dicht bewaldete Tal. Insgesamt misst die Heeressäule mehrere Kilometer. Die reichsten Franken auf ihren Pferden sind von Weitem zu erkennen: Sie tragen Helme, Lanzen und Panzerhemden aus eisernen Ringen, die im Sommerlicht funkeln. Die meisten Krieger, leichter bewaffnet, gehen zu Fuß. Ochsenkarren transportieren Nachschub und die Beute, die sie gemacht haben. Doch kehren sie nicht als Triumphatoren zurück ins Frankenland, die Stimmung wird gedrückt sein.
Woran denkt Karl in diesen Stunden? Sinnt er im Sattel über seinen Feldzug in Spanien nach, zieht er schon innerlich Bilanz? Zerbricht er sich womöglich den Kopf darüber, wie er diesen Rückschlag in der Fremde zu Hause doch noch als Erfolg verkaufen kann? Allzu leichtfertig, so muss es ihm jetzt erscheinen, hat er sich in Ränke eingemischt, von denen die Franken nicht genug verstehen.
Desaster in den Pyrenäen
Es begann damit, dass einige nach Unabhängigkeit strebende muslimische Provinzstatthalter aus dem Norden der Iberischen Halbinsel eine Gesandtschaft zu Karl in seiner Pfalz in Paderborn schickten und um Waffenhilfe gegen ihren Oberherrn, den Emir von Córdoba, baten. Im Gegenzug versprachen sie dem Frankenkönig, ihm die Stadt Saragossa auszuhändigen. Ein verführerisches Angebot. Karl, immer begierig, sein Reich zu vergrößern, rüstete zum Krieg.
Doch als er im folgenden Jahr tatsächlich mit seinem Heer vor den Mauern Saragossas erschien, hielten die Muslime entgegen der Absprache die Tore verschlossen. Damit war der Pakt gegen den Emir schon zerbrochen, bevor überhaupt eine Schlacht geschlagen worden war. Um ihren zugesagten Lohn betrogen, plünderten die Franken stattdessen Pamplona, eine von christlichen Basken bewohnte Stadt. Die Krieger aus dem Norden wollten nicht mit leeren Händen in die Heimat zurückkehren.
Dadurch aber hat Karl jene Katastrophe heraufbeschworen, die sein Heer an diesem Sommertag in den Pyrenäen treffen wird. Die Kämpfer, die am Pass von Roncesvalles lauern, sind keine muslimischen Araber oder Berber, sondern Basken. Sie wollen es den Franken heimzahlen, dass sie Pamplona angegriffen haben.
Geduldig lassen die baskischen Krieger den Großteil der fränkischen Truppen an sich vorüberziehen. Erst als der Tross mit Gepäck und Ausrüstung des Heeres und die Nachhut den Hinterhalt erreicht haben, stürmen sie aus ihren Verstecken oberhalb des Gebirgspfads. Die Franken, überrumpelt und desorientiert, haben zu wenig Platz, um ihre schweren Waffen einzusetzen, und werden ins Tal zurückgedrängt. Als der Abend dämmert, sind die Wagen ausgeraubt und die Kämpfer der Nachhut bis auf den letzten Mann erschlagen. (Unter den Toten ist auch der Markgraf Roland, er wird später in einem der großen Heldenepen des Mittelalters als idealer Ritter besungen werden.)
Der Frankenherrscher selbst kommt unversehrt davon und hat doch einen schmerzhaften Schlag erlitten. So peinlich ist das Debakel in den Pyrenäen für ihn, den Kriegerkönig, dass sich die Reichsannalen, die offizielle Version der fränkischen Geschichte, darüber ausschweigen (die Niederlage wird erst nach Karls Tod in einer überarbeiteten Version erwähnt). Schwerer noch als die militärische Blamage wiegt aber etwas anderes: Im fernen Land zwischen Rhein und Elbe werden Karls gefährlichste und eigentlich schon besiegt geglaubte Gegner diese Niederlage nutzen, um den Aufstand zu wagen – die Sachsen. Gegen sie muss der König nun seinen längsten und blutigsten Feldzug wiederaufnehmen.
Dieser Kampf wird Karl alles abverlangen, ihn zu ungekannter Grausamkeit provozieren und zugleich seine größte Stärke offenbaren: seine Hartnäckigkeit. Denn der Frankenherrscher wird nicht aufgeben, sondern mit Geschick und Weitblick sein Reich immer weiter ausdehnen, bis er alle Vorgänger übertroffen und nicht weniger als ein neues Zeitalter begründet hat.
Karls Sippe beginnt ihren Weg zum Gipfel der Macht mit einem Verrat. Als im Jahr 613, also rund ein Jahrhundert nach dem Tod Chlodwigs, mal wieder mehrere Merowinger um die Führung streiten, wenden sich die Adeligen in einem der fränkischen Teilreiche von ihrer Herrscherclique ab und bringen so dem König eines anderen den Sieg. Unter den Anführern der rebellischen Fraktion sind zwei von Karls Urururgroßvätern. Wohl als Belohnung erhält einer der beiden einige Jahre später erstmals ein hohes Amt: Er wird “Hausmeier”.
Der maior domus, so der lateinische Titel, war ursprünglich der Verwalter des königlichen Besitzes und verfügte nur über begrenzten Einfluss, doch nach und nach entwickelte sich das Amt zu einer Schlüsselposition im Frankenreich. Als die Merowinger im Laufe des 7. Jahrhunderts immer mehr von ihrer Autorität einbüßen, lenken die Hausmeier zunehmend die Geschicke in den Teilgebieten des Reiches, führen die Regierungsgeschäfte, als seien sie die rechtmäßigen Herrscher. Um 680 erlangt ein Urgroßvater von Karl dem Großen zunächst den Posten im Ostteil, um einige Jahre später zum tatsächlichen Machthaber im Gesamtreich aufzusteigen.
Dessen Sohn Karl (nach dem dereinst das Geschlecht der Karolinger benannt wird) ist der erste Hausmeier, der zur Legitimation seines Regimes keinen Schattenkönig mehr braucht. Als der amtierende Merowinger 737 stirbt, lässt Karl den Thron unbesetzt.
Seinem einige Generationen später geprägten Beinamen “Martell”, der so viel wie “der Hammer” bedeutet, macht er alle Ehre: Er führt Feldzüge von Friesland bis Bayern, er schlägt die muslimischen Araber und Berber, die weite Teile der Iberischen Halbinsel erobert haben und über die Pyrenäen bis nach Aquitanien vorgedrungen sind (der fränkische Triumph bei Tours und Poitiers wird später – zu Unrecht – als Rettung des christlichen Abendlandes verklärt werden). Karl Martell ist ein gewaltiger König in allem, bloß dem Titel nach nicht. Mit seinem Tod 741 wird das Reich unter seinen drei Söhnen aufgeteilt.
Mit 26 Jahren ist Karl Alleinherrscher der Franken
Doch einige Jahre später hat einer von ihnen, Pippin, die anderen Erben von der Macht verdrängt. 748 wird ihm ein Sohn geboren, der nach seinem kriegerischen Großvater den Namen Karl erhält. Dieser Knabe ist wohl noch keine drei Jahre alt, als Pippin sich, mit Zustimmung des Papstes, zum König erheben lässt. Der letzte Merowinger auf dem Thron wird zum Mönch geschoren und verschwindet in einem Kloster.
Im Jahr 768 tritt Karl die Nachfolge seines verstorbenen Vaters an. Er ist 20 Jahre alt, nach den Maßstäben der Zeit ein gestandener Mann. Der neue Herrscher hat gelernt, scharfe Eisen zu führen: Er ist gewandt im Schwertkampf wie in der gefährlichen Eberjagd mit der Lanze. Er kann lesen, allerdings wohl nicht schreiben. Er beherrscht Latein und ist, trotz seiner hohen Stimme, ein begabter Redner.
Mit sechs Jahren ist Karl das erste Mal dem Papst gegenübergetreten, mit 13 wohl ritt er auf seinem ersten Feldzug mit, etwa mit 19 heiratete er erstmals und zeugte einen Sohn: Pippin, den Chronisten später “den Buckligen” nennen. Der Mann, der nun die Königswürde annimmt, ist in der Welt des Hofes und des Krieges groß geworden. Er ist gut vorbereitet auf sein Erbe. Doch es ist ein lebensgefährliches Erbe, denn es kann zum Fluch werden, König der Franken zu sein.
Gleichzeitig nämlich wird auch Karlmann, der jüngere Bruder Karls, zum König erhoben. Es ist ja fatale Tradition bei den Franken, das Reich unter den Söhnen aufzuteilen. Karl beherrscht nun ungefähr den Norden und den Westen, der Rest untersteht seinem Bruder.
Es ist keine Verwünschung Karls über diese Teilung überliefert, kein einziges Zorneswort. Man kann das, was Karls Geist bewegt, nur durch seine Taten erschließen: Denn drei Jahre später ist die Familie des Bruders kaltgestellt. Es sind bloß Namen (und manchmal nicht einmal das), die eine Ahnung geben vom rücksichtslosen Machtkampf: Karl hat seinen Erstgeborenen Pippin genannt, nach dem Vater, dem ersten König der Karolinger. Und Karlmann tauft seinen nicht viel später geborenen ersten Sohn auf den gleichen Namen. Eine Provokation? Ein Zeichen, dass jeder Bruder für sich und die Seinen die alleinige Macht beansprucht?
Karl hat zudem seine erste Gattin Himiltrud verstoßen und statt ihrer eine Tochter des Langobardenkönigs in Norditalien geheiratet. Die Prinzessin, deren Namen kein Chronist überliefert, bedeutet ihm vermutlich nichts. Diese Ehe ist für Karl nicht mehr als ein strategisches Bündnis mit einem mächtigen König an der Grenze der Territorien seines Bruders. Denn irgendwann, das weiß er wohl, könnten er und Karlmann Heere gegeneinanderschicken.
Doch der Tod kommt schneller als der Krieg: Im Dezember 771 stirbt Karlmann überraschend, wohl auf natürliche Weise. Seine inzwischen zwei kleinen Söhne müssten nach fränkischem Brauch seinen Reichsteil erben. Doch stattdessen proklamieren die mächtigsten Gefolgsleute des Verstorbenen umgehend Karl zum Herrscher. (Gut möglich, dass der die Männer schon vor dem Tod des Bruders auf seine Seite gezogen hat.)
Das Bündnis mit den Langobarden hat Karl da bereits wieder aufgegeben. Die Prinzessin, so scheint es, schickt er vermutlich schon Anfang des Jahres wie eine nutzlos gewordene Sache zurück in ihre Heimat – und nimmt eine junge Adelige zur Gemahlin, deren Vater großen Einfluss im Machtbereich seines Bruders besitzt.
Wieder eine Ehe als strategischer Zug: Durch diese Verbindung festigt Karl seine Herrschergewalt. (Vermutlich nur etwa 13 Jahre alt ist seine Braut Hildegard, als Karl sie zur Frau nimmt. In zwölf Ehejahren wird sie ihm mindestens neun Kinder gebären, bis sie, man möchte sich ihren körperlichen und seelischen Zustand kaum vorstellen, mit Mitte 20 ins Grab sinkt.)
Nun sucht die Witwe Karlmanns Schutz bei einem starken Herrscher, und zwar ausgerechnet bei den Langobarden: Mit ihren Kindern flieht sie, nichts Gutes ahnend, zu Karls früherem Schwiegervater. Es wird sie nicht retten.
Denn Karl offenbart nun erstmals jene Eigenschaften, die ihn sein gesamtes Herrscherleben über auszeichnen werden: strategischer Weitblick und eine fast fanatische Beharrlichkeit. Anderthalb Jahre rüstet er, dann führt er eine Armee über die Alpen, gegen die Langobarden, die längst seine Feinde sind. Seine Panzerreiter fallen in Norditalien ein, die Angegriffenen ziehen sich in die Städte zurück. Doch Karl lässt die Festungen belagern, Monat um Monat. Im Frühsommer 774 kollabiert das Langobardenreich, die ausgehungerten Verteidiger der Hauptstadt Pavia strecken die Waffen. Rex Francorum et Langobardorum lässt sich Karl fortan nennen, “König der Franken und Langobarden”.
Im ebenfalls eroberten Verona haben die Besiegten ihm die Witwe seines Bruders und deren Söhne ausgeliefert, lebend. Was Karl mit der Schwägerin und seinen Neffen macht, weiß niemand. Kein Chronist schreibt auch nur ein Wort.
Mit 26 Jahren ist Karl, wie einst Chlodwig, unangefochtener Alleinherrscher der Franken; sein Einfluss erstreckt sich zudem nun bis an die Pforten Roms, denn bis dorthin reicht das Territorium der Langobarden. Der Karolinger wird zum übermächtigen Nachbarn des Papstes.
Die militärischen Erfolge in Italien ermutigen den König, seine Aufmerksamkeit ganz auf die Sachsen zu richten, mit denen die Frankenherrscher schon seit mehr als zwei Jahrhunderten immer wieder Krieg führen. So zog etwa ein Sohn des großen Chlodwig in den Jahren um 555 gleich zweimal gegen die nordöstlichen Nachbarn. Angeblich erschlug dessen Enkel bei einer weiteren Invasion einen ihrer Herzöge. Unterwerfen konnten die Merowinger die Sachsen aber nicht. Und so sind die meisten Bewohner des Gebietes zwischen Rhein und Elbe auch noch zu Karls Zeiten ungetauft. Fränkische Quellen verteufeln die sächsischen Heiden, bezichtigen sie, einem “Dämonenkult” anzuhängen.
Karl vertraut auf Gott – und auf Gewalt
Als christlicher Herrscher sieht es Karl als seine Pflicht an, die Botschaft Jesu zu verbreiten. Er, der in seinem Handeln vor allem auf zwei Kräfte vertraut – den Glauben und die Gewalt –, ist auf brutale Art fromm: “Unsere Aufgabe ist es, überall Christi heilige Kirche nach außen vor der Zerstörung durch Ungläubige mit Waffen zu schützen und im Innern durch die Erkenntnis des allgemeinen Glaubens zu stärken”, schreibt er einmal an den Papst. Karl, notiert ein frommer Autor ein gutes Jahrhundert später, predige das Christentum “mit eiserner Zunge”.
Dabei gilt es, keine Zeit zu verlieren. Wie viele seiner Mitmenschen wähnt der Frankenkönig das Ende aller Tage nahe, fürchtet sich wohl auch vor dem Urteil, das beim Jüngsten Gericht über ihn gefällt werden wird. So sind die Schlachten, die er gegen die Ungläubigen schlägt, zugleich auch ein Kampf um das eigene Seelenheil.
Schon 772 ist Karl zum ersten Mal in das Land der heidnischen Sachsen eingefallen. Die Franken eroberten wichtige Stützpunkte, nahmen Geiseln. Und sie zerstörten die Irminsul, ein bedeutendes Heiligtum des Heidenvolks, vielleicht ein großer Baumstamm, den die Sachsen als “Weltensäule” verehrten, die alles trägt. Ihr genauer Standort lässt sich heute nicht mehr ermitteln, wahrscheinlich befand sie sich irgendwo im Bereich der oberen Weser. Wenn der König glaubte, dass er damit dem Feind das Rückgrat gebrochen hatte, dann irrte er sich. Die Sachsen geben nicht auf.
Nach seinem Sieg über die Langobarden zieht Karl erneut gegen sie in den Krieg. Erst im Jahr 777 scheint er endlich am Ziel zu sein: In Paderborn, mitten im Heidenland, versammelt er seine führenden Adeligen zu einem Reichstag. Das Treffen ist eine Machtdemonstration, der auch die sächsische Elite nicht fernbleiben kann. In der Pfalz, die Karl an einem Hang oberhalb etlicher sprudelnder Quellen hat errichten lassen, schwören sie ihm die Treue.
Ein einflussreicher Sachse aber fehlt: ein Mann namens Widukind. Er ist nach Dänemark geflohen, wo er wohl auf eine günstige Gelegenheit wartet, den Kampf gegen die Franken wiederaufzunehmen. Als deren so kraftvoller König bei Roncesvalles ein Debakel erlebt, das den Glauben an die vermeintliche Unbesiegbarkeit der Franken erschüttert, sieht der Sachsenführer seine Chance gekommen – und geht in die Offensive.
Im Jahr 778 ziehen sächsische Kämpfer plündernd durch die angrenzenden fränkischen Lande, stoßen sogar bis zum Rhein vor, den sie allerdings nicht überqueren können. Köln, eine der wichtigsten Städte des Reiches, bleibt für sie uneinnehmbar. Dafür zerstören die Rebellen unter anderem den fränkischen Stützpunkt in Paderborn, wo die Sachsen noch im Vorjahr Karl gehuldigt hatten.
Taufe statt Tod
Dem König bleibt nichts, als erneut selbst gegen die Sachsen zu ziehen, um die Situation zu stabilisieren. Doch Widukind kapituliert nicht. 782 – Karl ist gerade wieder nach Gallien zurückgekehrt – besiegt er sogar an einem Höhenzug (möglicherweise im Süntel nördlich von Hameln) ein überlegenes fränkisches Heer. Jetzt sinnt Karl erst recht auf Rache. Schon Jahre zuvor hat er geschworen, die Sachsen so lange zu bekämpfen, bis sie besiegt sind und sich taufen lassen oder aber gänzlich ausgerottet wären.
Und er macht Ernst damit: Noch im Jahr 782 zurück in Sachsen, lässt sich Karl von den ihm ergebenen dortigen Adeligen die “Übeltäter” ausliefern und diese, angeblich 4.500 Mann, an einem einzigen Tag köpfen. Diese Zahl jedenfalls ist in den offiziellen Annalen des Frankenreichs überliefert. Doch waren es wirklich so viele, die am Zusammenfluss von Weser und Aller, beim heutigen Verden, gestorben sind? Auf jeden Fall färbt sich die Erde rot vom Blut.
Zudem erlässt Karl für die Sachsen spezielle Gesetze, die schon bei geringen Vergehen den Tod vorsehen, und presst ihnen den Zehnten als Abgabe an die Kirche ab. Im Sommer 783 reitet der König schließlich selbst in die Schlacht. Am Fluss Hase will er die Entscheidung gegen die dort versammelten Sachsen erzwingen. Einzelheiten dieses Kampfes, der irgendwo bei Osnabrück ausgefochten wird, werden nirgendwo niedergeschrieben. Einhard, ein fränkischer Gelehrter und Vertrauter Karls, schreibt lakonisch: “Die Feinde wurden so niedergeworfen, dass sie es danach nie wieder wagten, den König herauszufordern oder ihm Widerstand zu leisten, wenn sie nicht durch eine Befestigung geschützt waren.”
Trotz des Erfolges führt Karl weiter Krieg in der Region, Teile der Sachsen werden noch 20 Jahre weiterkämpfen. Widukind aber, Karls großer Rivale, streckt nun seine Waffen. 785 nimmt er in der Pfalz im nordfranzösischen Attigny den christlichen Glauben an. Angeblich übernimmt der Frankenherrscher persönlich die Patenschaft. Taufe statt Tod.
778 wird für Karl ein übles Jahr
Karl ist 24, als er die Irminsul zerstört. Er ist 56, als sich endlich die letzten Sachsen unterwerfen – und, wie Einhard schreibt, das Ziel des Königs erreicht ist, dass die Sachsen “sich mit den Franken zu einem Volk vereinigen”. Ein sanfter Satz für die brutale Realität, dass die Sachsen ihre Religion und ihre Unabhängigkeit aufgeben mussten, um im Frankenreich aufgesaugt zu werden. Und nicht wenige auch ihre Heimat: Männer, Frauen und Kinder, ganze Dorfgemeinschaften lässt Karl in entfernte Teile seines Imperiums deportieren.
Während der mehr als 30 Jahre andauernden Schlächterei im Sachsenland hat Karl auch noch Willen und Kraft, an anderen Fronten zu kämpfen: Herzog Tassilo von Bayern, seinen eigenen Vetter, der sein Land trotz der fränkischen Oberherrschaft wie ein König regiert, zwingt er zur Unterwerfung, macht ihm wegen Fahnenflucht einen Schauprozess und lässt den Besiegten hinter Klostermauern verschwinden.
Er schickt Heere gegen die Mauren und entreißt ihnen Nordostspanien um Barcelona, bringt so schließlich auch jene Region unter seine Kontrolle, in der er im Sommer 778 einen seiner schwersten Rückschläge erlitten hat. Die Awaren, ein heidnisches Reitervolk, besiegen seine Truppen im heutigen Ungarn. Er bezwingt Aufstände in Aquitanien und der Bretagne.
Gut möglich, dass sich Karl zum Krieg verdammt fühlt. Er, der Herrscher einer noch jungen Dynastie, gewinnt mit jedem Sieg Ansehen und Beute – Raubgut, das er an die Adeligen verteilt, um sich deren Loyalität zu erkaufen.
Doch ausgerechnet dieser Kriegerkönig, der wohl mehr als drei Jahrzehnte im Sattel sitzt (rechnet man alle Feldzüge und Reisen durch sein Imperium zusammen) und auf dem Pferderücken eine Strecke zurücklegt, die vermutlich mehrfach um die ganze Erde reichen würde: Ausgerechnet dieser rücksichtslose Totschläger ahnt, dass man auf Dauer mit dem Schwert allein kein Reich zusammenfügen kann. Schon die Frage nach den Grenzen dieses Reiches ist schwer zu beantworten. Wo genau liegen sie? Manchmal am Meer, das ist noch einfach. Doch oft genug verlaufen sie – im Norden, Osten, in Spanien, in Italien – im Ungefähren.
Auf gut eine Million Quadratkilometer werden Gelehrte die Ausmaße dieses Imperiums später schätzen – etwa dreimal so groß wie das heutige Deutschland. Vielleicht 20 Millionen, womöglich auch nur zehn Millionen Menschen leben in den Weiten des Reiches. Manche Teile, vor allem jene östlich des Rheins, die nie zum Römischen Reich gehörten, sind so dünn besiedelt, dass man wochenlang auf verschlammten Wegen, auf unregulierten Flüssen unterwegs sein kann, ohne eine einzige Seele zu sehen.
Die Frankenherrscher sind Reiseherrscher
Karl träumt davon, Schneisen durch dieses Dickicht zu schlagen. Er lässt einen Kanal graben, der eine Verbindung zwischen Main und Donau ermöglicht, doch in unendlichen Regenfällen rutscht die Erde ab, sodass die Arbeiter bald erschöpft aufgeben. Er lässt bei Mainz eine hölzerne Brücke über den Rhein bauen, “die zehn Jahre schwerste Arbeit gekostet hatte”, berichtet sein Biograf Einhard. “Durch ein zufällig entstandenes Feuer wurde sie dann binnen dreier Stunden vollkommen eingeäschert, sodass nicht einmal ein Holzspan von ihr übrig blieb.”
Wie es den Menschen geht? Karl, der privilegierteste, am besten umsorgte Mann im ganzen Reich, hat mindestens 18 Kinder von diversen Haupt- und Nebenfrauen – doch drei Königskinder sterben schon als Säuglinge, die meisten anderen holt der Tod im zweiten, dritten, vielleicht vierten Jahrzehnt, wohl nur eine einzige Tochter und ein Sohn werden älter als 60.
Für Karls Untertanen schweigen die Quellen, doch sicher ist wohl, dass der Tod in den Hütten noch früher erscheint als in den Palästen. Alle drei bis fünf Jahre, das verraten Skelettbefunde, suchen Hungersnöte einige Regionen heim.
Was an Städten aufragt, sind fast ausnahmslos Reste aus römischer Zeit, zahllose in Italien und Gallien, manche auch im heutigen Deutschland: Köln, Trier, Mainz, Regensburg. Karl setzt aber auch in die Wälder jenseits von Rhein und Donau systematisch Siedlungen, zumal im neu eroberten Sachsen: Königsresidenzen, Klöster, Bischofssitze, Handelsplätze. Neben den alten Römerprovinzen tritt so nun das Land bis zur Elbe in die Geschichte ein.
Die Frankenherrscher sind Reiseherrscher. Kaum je bleiben sie mehr als ein paar Wochen an einem Ort, höchstens im Winter wenige Monate. Zwar erlässt Karl Dutzende Zusammenstellungen von Gesetzen und Anordnungen, lässt er die bis dahin nur mündlich überlieferten Rechte von unterworfenen Völkern wie Friesen und Sachsen erstmals aufschreiben, verwalten Grafen für ihn noch die entlegensten Regionen, ziehen adelige Königsboten als Oberaufseher durch das Reich. Doch in einer Welt, in der selbst der König oft Wochen warten muss, bis er auf einen Brief eine Antwort erhält; in der kaum je ein Untertan ein Wort an die Herrschenden äußert (denn wer könnte schon schreiben, wer strapaziöse lange Reisen auf sich nehmen?); in der Adelige noch der archaischen Blutrache verpflichtet sind und Grafen ob ihrer Habgier als “Freunde Satans” geschmäht werden; in einer Welt der Finsternis also reicht die Macht des Herrschers oft nur so weit wie sein Augenlicht.
Da, wo Karl ist, beseitigt er Missstände, sitzt zu Gericht, verwaltet seine Güter, setzt Gefolgsmänner auf vakante Grafenposten. Hat er in einer Region Ordnung geschaffen, muss er weiterziehen und weiter und weiter – schätzungsweise 150 Königssitze stehen zwischen Ebro und Elbe. Manche dieser “Pfalzen” (vom lateinischen Wort für “Palast”: palatium), etwa Worms, sind bedeutender als andere, hierhin werden die Adeligen des Reiches zu Versammlungen einbestellt. In den ersten Jahrzehnten seiner Herrschaft sucht Karl häufig jene Residenzen auf, die schon seine Vorgänger bevorzugt haben, zum Beispiel Quierzy (nordöstlich von Paris) oder Herstal (an der Maas im heutigen Belgien). Später aber verschiebt sich der Schwerpunkt seines Reiches nach Osten in Richtung Rhein.
Die meisten Pfalzen indes sind kaum mehr als große Gutshöfe: Wenn Karl dort residiert, wird er morgens mit Pferdewiehern aufwachen, und in den Duft nach Wein und Braten mischt sich der Gestank von Dung und feuchtem Stroh.
Eine Kirche zu Karls und Gottes Ehren
Der Zug von Pfalz zu Pfalz ist beschwerlich. Und er ist auch gefährlich, denn manchmal wissen nicht einmal Grafen und Vertraute, wo der Herrscher sich gerade aufhält. Wäre ein zentraler Ort, komfortabel und prächtig, nicht eines Königs angemessener?
Aachen, Marienkirche, 796. Eine Messe zur Einweihung der noch unvollendeten Kirche. Schon der Rohbau lässt erkennen: Dieses Gotteshaus wird ein Gebet in Stein, ein gelehrtes Buch, das nur der Eingeweihte zu lesen versteht. Das fertige Gotteshaus wird mit der höchsten Kuppel nördlich der Alpen überwölbt sein, 30 Meter über den Häuptern der Gläubigen. Der achteckige Innenraum hat eine byzantinische Kirche in Ravenna zum Vorbild, in der Karl einige Jahre zuvor gebetet hat. Antike Säulen und anderen wertvollen Schmuck für den Innenausbau lässt der König aus Italien holen.
Grundriss und Maße der Kirche folgen einer mystischen Logik, bei der es vor allem um die Zahlen 6, 8, 16 und 144 geht. Die 6 gilt gelehrten Theologen als Zahl des Menschen, denn Gott schuf ihn am sechsten Tage. Die 8 ist das Zahlzeichen der Auferstehung und Erlösung, nach dem Evangelium des Matthäus zudem die Zahl der Seligpreisungen, und acht Mühen muss der Gläubige nach einem Petrus-Brief auf sich nehmen, um zur Erkenntnis Jesu Christi zu gelangen. 16 Eigenschaften hat die Liebe, so schreibt der Apostel Paulus. Und 144 ist das Quadrat von 12, dem Zahlsymbol der Vollständigkeit – 144.000 Gläubige werden gemäß der Offenbarung des Johannes am Tag der Apokalypse gerettet werden.
Daher formen im Zentrum des Gotteshauses acht Pfeiler ein Oktogon. Der Durchmesser dieses Achtecks beträgt sechs mal acht karolingische Fuß (ein Fuß entspricht gut 32 Zentimetern), darüber wölbt sich in zwölf mal acht Fuß Höhe die Kuppel. Umschlossen ist dieses Achteck von einem 16-seitigen Umgang.
Die Länge der Kirche misst 144 Fuß, und in der Höhe leuchtet ein Bild des Weltenrichters, um den 144 Sterne glänzen. Drei Bogenfelder sind unter dem Bild errichtet, Symbol der heiligen Dreifaltigkeit. Und drei mal sechs mal acht ergibt wiederum 144: Die Zahl der gelehrten Anspielungen im Gotteshaus ist so unendlich wie im Text der Bibel.
In der Aachener Kirche verdichtet sich die Kraft des Riesenreiches auf wenigen Quadratmetern unter einem einzigen Dach: Karl schafft die wertvollsten Materialien aus dem Reich, ja von jenseits des Meeres heran. Und er fordert die intellektuelle Kraft der Baumeister bis zum Äußersten. Der König errichtet hier mehr als nur eine Kirche: Er baut ein Abbild des himmlischen Jerusalem ins Zentrum seines Reiches.
Zwar wird er niemals offiziell eine Pfalz zur alleinigen Hauptstadt erheben. Doch ab den 790er Jahren, als seine Herrschaft gesichert scheint und er längst kein junger Mann mehr ist, hält er sich häufiger in Aachen auf als an jedem anderen Ort seines Reiches, verbringt er fast jeden Winter hier. Die Kirche ist bloß der monumentalste Ausdruck seines Willens.
Aachen mit seinen bis zu 60 Grad heißen Quellen ist, einmal mehr, ein Relikt der Antike. Auf den Trümmern der römischen Bäder erbaute schon Karls Vater eine Pfalz. Der Sohn, ein begeisterter Schwimmer, entspannt sich im Thermalwasser und lässt die Quellen in Becken fassen. In den Wäldern von Ardennen und Eifel geht er seiner Leidenschaft für die Jagd nach.
Schon sein erstes Weihnachtsfest als König zelebriert Karl in Aachen. Doch wohl erst Jahrzehnte später lässt er die Pfalz nach seinen Vorstellungen ausbauen. Die Königshalle und die meisten anderen Bauwerke sind in späteren Zeiten allerdings wieder verschwunden. Nur seine Kirche, die ist geblieben. Wie leben, wie arbeiten Karl und seine Gefolgsleute in Aachen? Wenig weiß man von seinen Höflingen, nicht viel von den meisten Ehefrauen, Konkubinen, Kindern. Wohl 2000 Menschen umschwirren den Herrscher, vom Seneschall, dem obersten Hofbeamten, bis hinunter zum Küchengesinde.
Pippin der Bucklige wird zum Mönch geschoren
Der Mächtige genießt es, überliefert Einhard, mit seinen Getreuen in den heißen Quellen zu baden. Wird dort ein Graf in wohligen Nebelschwaden über den nächsten Feldzug flüstern? Wird eine seiner Frauen auf irgendeiner Schlafstatt irgendeiner Pfalz durch ein wohlgesetztes Wort einen Günstling auf einen wichtigen Posten hieven? Scharen sich um die erbberechtigten Söhne Anhänger, Opportunisten, Unzufriedene?
Denn Pippin, dem ersten Sohn Karls mit Himiltrud, sind drei Sprösslinge mit Hildegard gefolgt, der dritten Gattin, die sich nun Hoffnung machen dürfen, einen Teil von Karls Reich zu erben – oder gar das ganze Imperium? Planen sie oder ihre Einflüsterer schon die Machtduelle nach dem Hinscheiden Karls?
Nur so viel ist bekannt: Als Karl einmal wegen des Krieges gegen die Awaren in Bayern überwintert, im Jahr 792, so schreibt Einhard, sei Pippin der Bucklige zum Kopf einer Verschwörung gegen den eigenen Vater geworden. “Führende Franken” hätten den Prinzen dazu aufgewiegelt. Die “Grausamkeit” seiner Stiefmutter Fastrada – der inzwischen vierten Gattin Karls – sei “Grund und Ursprung” der Rebellion gewesen.
Was genau sich zugetragen hat und warum, das berichtet Einhard nicht. Möglich, dass Pippin aufbegehrt, weil der Vater die drei jüngeren Söhne aus der Ehe mit Hildegard bereits vor Jahren in verantwortungsvolle Ämter gehoben hat, zwei davon zu Königen in verschiedenen Teilen seines Reiches. Möglich aber auch, dass Karl ihn nun doch an der Regierung beteiligen will. Und dass Fastrada – in der Hoffnung auf einen eigenen Sohn – Pippin durch Intrigen beiseiteschaffen will.
Sicher ist nur, dass der Coup auffliegt und Karl die Verantwortlichen bestraft, den Sohn jedoch eher milde: Pippin der Bucklige wird zum Mönch geschoren und in die Abtei Prüm gebracht. Das Hauskloster der Karolinger in der Eifel liegt wenige Tagesreisen von Aachen entfernt, und doch verschwindet der Älteste für immer aus der Welt. Viele Jahre wird er noch hinter Mauern leben, und falls es wirklich Fastradas Machenschaften waren, die ihn in die Rebellion getrieben hatten, dann wird ihm wenigstens die Befriedigung vergönnt, sie überdauert zu haben. Denn die Königin stirbt, kinderlos, schon zwei Jahre nach der Verschwörung.
Dass überhaupt ein paar Zeilen jener Geschehnisse durch die Jahrhunderte wehen, verdankt sich einer Tat von Karl, die womöglich folgenreicher ist als alle seine Feldzüge: Er holt sich, weit mehr als jeder Frankenherrscher zuvor, Gelehrte an den Hof, Männer der Schrift und nicht des Schwertes.
Zu der Zeit, als Karl an die Macht gelangt, ist die römische Kultur, die zu Chlodwigs Zeiten in Gallien noch blühte, einem jahrhundertelangen Niedergang erlegen. Der König muss sich aus Italien und von jenseits der Grenzen gelehrte Männer des Wissens holen, er ernennt sie zu Beratern und Lehrern am Hof, lässt sie Schulen gründen, alte Manuskripte retten, Klöster und Bistümer leiten. Was von der antiken Literatur heute noch existiert, das wird unter anderem in jenen Jahrzehnten der “karolingischen Renaissance” geborgen.
Der Traum vom Imperium
Mancher moderne Biograf sieht in Karl, dem Krieger, der zeitlebens wohl nie richtig Schreiben lernt, sogar eine Art verhinderten Gelehrten. Tatsächlich hebt ihn sein Bemühen um die Wissenschaften über seine Zeitgenossen heraus. Er hat begriffen, dass sie der Schlüssel zum Verständnis der Welt sind. Und nur wer die Welt versteht, kann sie beherrschen.
Die Gelehrsamkeit, die der Franke an seinem Hof fördert, weist über das Weltliche ins Spirituelle. Karl, tief religiös, glaubt auf nahezu magische Weise an die Korrektheit des Gotteswortes: Nur wenn Gebete und Evangelien, Hymnen und Psalmen fehlerfrei gesprochen werden, sind sie wirksam vor Gott.
Hat Gott ihn, Karl, nicht wegen seiner Frömmigkeit zum mächtigsten Mann des Erdkreises werden lassen – und weil er den rechten Glauben verbreitet? Hat er ihn damit nicht schon über all die anderen weltlichen Herrscher erhoben? Und gebührt ihm dann nicht auch das allerhöchste weltliche Amt? Das des Kaisers?
Niemand kann sagen, wann in Karls Geist die Idee heranwächst, er könnte sich zum Imperator aufschwingen. Seit dem Untergang Westroms in den Wirren der Völkerwanderungszeit ist kein abendländischer Fürst auf den Gedanken gekommen, sich den legendären Titel des Augustus anzumaßen. In Konstantinopel, in Ostrom, residiert ja weiterhin ein Kaiser; der allein gilt Griechen, Italienern, Galliern und auch den Nachfahren der germanischen Eroberer als legitimer Erbe antiker Größe.
Folgen schon Karls schier endlose Kriegszüge dem Traum vom Imperium? Steht schon am Beginn seiner Eroberungen die Gier nach dem Kaisertitel? Erobert er sich, soweit seine militärische Kraft reicht, die Länder Westroms, damit er schließlich auch dessen Titel beanspruchen kann? Oder steht das Kaisertum nicht am Beginn, sondern am Ende? Rafft Karl zusammen, was er bekommen kann – und macht sich dann erst, als Sieger, Gedanken, wie er seine Beute nun regieren soll? Und entscheidet er sich dann erst für den alten Titel? Kein Wort von ihm ist dazu überliefert, doch von anderen sehr wohl – und sie deuten an, dass Karl schon sehr früh vom Kaisertum träumt.
Als der 26-Jährige das Reich der Langobarden in Italien vernichtet und damit Papst Hadrian I. vor deren Übergriffen bewahrt, besucht er erstmals Rom. Rom! Antike Tempel, prachtvolle Kirchen, Paläste und Thermen, die noch als Ruinen glänzender sind als jede Pfalz. Als patricius Romanorum empfängt der Heilige Vater den Frankenkönig: als obersten Schutzherrn der Römer. In einem Brief von 778 redet Hadrian dann Karl bereits als novus christianissimus Dei Constantinus imperator an, als “neuen, Gottes allerchristlichsten Kaiser Konstantin”.
Schon lange predigen Geistliche zudem, dass im 6.000. Jahr nach der Schöpfung ein Zeitalter zu Ende geht. Entweder wird die Apokalypse heraufdämmern – oder ein neues Zeitalter beginnen. Wann wird sich dieser Zyklus vollenden?
Bischof Hildebald von Köln, einer der engsten Berater des Herrschers, lässt 798 in einer Handschrift mehrere Weltaltersberechnungen zusammenstellen. Zumindest einige davon erwarten den Beginn der neuen Ära, an deren Ende Christus als Weltenrichter erscheint, für die nächste Zukunft: für Weihnachten im Jahr 800. Womit aber könnte eine neue Ära sinnfälliger beginnen als mit einem neuen Kaiser?
Um die Zeit, als der Bischof die Berechnungen der Weltzeitalter kompiliert, schickt Karl Gesandte in alle Richtungen, bis in den Orient zum Kalifen Harunar-Raschid. Meldet er mit diesen diplomatischen Manövern auch den Anspruch an, der Erbe der Cäsaren zu sein? Bischof Hildebald erwähnt gar in besagter Schrift, im Jahr 798 seien Gesandte “aus Griechenland” – also aus dem Oströmischen Reich – zu Karl gekommen, “um ihm die Kaisergewalt zu übertragen”.
Offizielle Chroniken der Franken schweigen zwar darüber, auch die Geschichtsschreiber des Papstes oder des Kaisers in Konstantinopel erwähnen nichts davon. Trotzdem ist es möglich, dass Karl auch mit Ostrom Verhandlungen aufgenommen hat, um sich vielleicht abzusichern, dass seine bevorstehende Kaiserkrönung dort nicht als Kriegsgrund gesehen wird.
In den Gemächern des Papstes wie in den Hallen der fränkischen Pfalzen und vielleicht auch in den Palästen von Konstantinopel und sogar im Reich des Kalifen ahnt man wohl spätestens 798, dass sich der Karolinger zum Kaiser erheben will.
Es spricht alles dafür, dass auch Karl selbst sich so sieht, als Wiederhersteller alter Größe, als jemand, der dem Verfall entgegentritt: dem Verfall des Glaubens der Kirchenväter, der römischen Straßen und Städte, der hergebrachten Gesetze, der antiken Literatur und Gelehrsamkeit, des Lateins. Daher führt er nicht bloß Kriege, sondern gründet Schulen, fördert Gelehrte, sammelt Manuskripte, lässt Brücken und Kanäle bauen, errichtet in Aachen eine Kirche nach antiken Vorbildern, gründet Bistümer und Klöster, überschüttet seine Untertanen mit Gesetzen um Gesetzen.
Weil Karl Kaiser sein will, regiert er wie ein Kaiser. Und weil er wie ein Kaiser regiert, hat er irgendwann das Anrecht auf den Kaisertitel. Am Ende ist es der Papst selbst, der zum Anrecht auch noch den passenden Anlass liefert.
Leo III. ist der Nachfolger Hadrians – und ein Aufsteiger, der es 795 auf den Stuhl Petri geschafft hat, bei den alten stadtrömischen Adelsfamilien jedoch, die seit Langem das Papsttum meist unter sich verschachert haben, ist er verhasst. Genaueres weiß man, wie so oft, nicht über die Intrigen hinter Palastmauern. Nur dies: Bei einer Prozession am 25. April 799 wird der Heilige Vater mitten in Rom von Schlägern überfallen, misshandelt und in den Kerker geworfen. Seine Gegner aus den alten Adelsfamilien werfen ihm Meineid und Ehebruch vor.
Doch der Papst kann aus der Haft entkommen und rettet sich zu Karl in dessen Pfalz Paderborn. Ausgerechnet im bis vor Kurzem noch heidnischen Sachsenland empfängt der König seinen hohen Gast – und demonstriert dem Heiligen Vater nebenbei, wie erfolgreich er den christlichen Glauben verbreitet hat.
Welche Seite in der Seele des Kaisers mag in den kürzer werdenden Tagen des verwehenden Jahrhunderts nun die Oberhand gewinnen?
Zum einen ist da seine tiefe Frömmigkeit: Papst Leo III. von den Römern gestürzt und entehrt – ist das möglicherweise ein Vorzeichen der Apokalypse? Einige seiner engsten Berater sehen es so. Und wird, wie in manchen von Bischof Hildebalds Berechnungen, am 25. Dezember 800 tatsächlich ein neues Zeitalter beginnen?
Zum anderen ist da der kühle Machtmensch Karl: Sieht er nicht die Endzeit heraufdämmern, sondern vielmehr eine günstige politische Gelegenheit? Der Papst ist ja nahezu machtlos in seiner Hand. Wenn der Franke nun nach dem Kaisertitel griffe – wer würde es noch verhindern können?
So oder so: Seine Getreuen flüstern ihm jedenfalls ein, die Tat zu wagen. “Auf Dir allein beruht das ganze Wohl der Kirche Christi”, versichert sein angelsächsischer Berater Alkuin. “Du führst die Schlüssel der Kirche”, souffliert ein anderer.
Noch im Herbst 799 lässt Karl den Papst von einer Eskorte heim nach Rom geleiten. Er selbst macht sich mit seinen Kämpfern ein Jahr später auf den Weg. In der Stadt leiten König und Papst gemeinsam eine Versammlung hoher Geistlicher und Laien, an deren Ende Leo III. durch einen Eid beschwören muss, dass alle gegen ihn gerichteten Vorwürfe erfunden sind. Karl ist derjenige, der die Kirche ordnet, der Papst tritt vor ihn, als sei er sein Gefolgsmann. Dann ist Weihnachten, das neue Zeitalter dämmert herauf.
Rom, Santa Maria Maggiore, 25. Dezember 800, Mitternacht. Die ersten Stunden des Geburtsfestes Christi verbringt der Papst im Gebet, wie es die Tradition verlangt. Gesänge wehen durch die Basilika auf dem Esquilin, einem der legendären sieben Hügel der Tiberstadt.
Kerzen brennen, kostbare Lichtspender in einer Welt der Düsternis. Ihr rötlicher Glanz umspielt Seine Heiligkeit Leo III. vor dem Altar. Im Kirchenschiff knien Bischöfe und Grafen, Mönche, Gelehrte, Handwerker, Diener, Pöbel, das Volk von Rom. Die Gläubigen werden, auch wenn das keiner so überliefert hat, aufmerksam aus dem Dämmer starren, vielleicht sensationslüstern, vielleicht in stummer Scheu – doch nicht auf den Papst, nicht auf das Kreuz.
Sondern auf den geheimnisvollen, den schrecklichen Fremden.
Der Mann überragt die Römer und selbst die meisten Angehörigen seines eigenen Gefolges. Graue Haare, auffallend große Augen, Stiernacken; die geschmeidigen Bewegungen eines Schwertkämpfers und der Gang eines Mannes, der die meisten seiner 52 Jahre im Sattel verbracht hat.
Der Frankenkönig Karl, der inzwischen übermächtige Verbündete des Papstes, ist mit Prinzen, Beratern und einem Heer seiner schlachterfahrenen Panzerreiter aus dem Norden gekommen, und er feiert Weihnachten in Rom.
Moment des höchsten Triumphs
Jede seiner Gesten werden die Gestalten im Kirchendämmer beobachten. Spürt Karl die tausend Blicke? Die Worte der Gebete spricht er mit tiefer Frömmigkeit, Latein fließt aus seinen Lippen. Nach der Mitternachtsmesse führen Leo III. und Karl die Gläubigen in einer Prozession zur Kirche der heiligen Anastasia. Das Gotteshaus steht am Fuße des Palatins, eines anderen der sieben Hügel Roms.
Vorbei geht es an Ruinen des Imperium Romanum. Oben auf dem Palatin, im Dunkel des Wintermorgens noch verhüllt, Klippen aus Ziegeln und Marmor, selbst im Verfall noch ehrfurchtheischend: die Reste der römischen Kaiserpaläste.
Karl wohnt vermutlich, in angemessener Demut, auch diesem Gottesdienst bei. Dann noch eine weitere Messe der Weihnacht. Papst und Herrscher führen das Gefolge mitten durch die Tiberstadt. Queren den Fluss, überspannt von Brücken, die noch die antiken Römer schlugen. Am jenseitigen Ufer eine Basilika aus Konstantins Zeiten: Sankt Peter.
Das Innere der Kirche eine Allee polierter Säulen. Der Altar errichtet an jener Stelle, wo der Überlieferung nach die Gebeine des Apostelfürsten Petrus ruhen.
Auch diese dritte Messe am Weihnachtstag folgt der festgelegten Liturgie. Dann aber geschieht höchst Ungewöhnliches: Der Heilige Vater setzt Karl eine kostbare Krone aufs Haupt. Unmittelbar darauf erhebt das Kirchenvolk seine Stimme zu einem mächtigen Ruf. Dreimal brandet dem Gekrönten ein Satz entgegen, hallt wider zwischen Säulen und Altären: “Karl, dem allerfrommsten Erhabenen, von Gott gekrönt, dem großen und friedenstiftenden Imperator Leben und Sieg!”
Mit dieser Formel akklamieren die Anwesenden den Franken zum Kaiser der Römer. Es sind Worte, wie sie hier seit Jahrhunderten nicht mehr vernommen worden sind.
Was genau während jener Messe am Vormittag des 25. Dezember 800 zu Rom geschieht, wird wohl niemals ganz geklärt werden, obwohl, nein gerade weil vier zeitnah verfasste Berichte darüber vorliegen: zwei fränkische Annalen, eine Chronik der Päpste sowie Einhards Zeugnis.
“Bei dieser Gelegenheit erhielt er den Kaiser- und Augustus-Titel”, schreibt Einhard in erstaunlicher Lakonie. Dann fügt der Biograf bloß noch hinzu, Karl habe dieser Titel “anfangs so widerstrebt, dass er erklärte, er würde die Kirche selbst an jenem hohen Feiertage nicht betreten haben, wenn er die Absicht des Papstes geahnt hätte”.
Karl, der Herr des Abendlandes und Beschützer der Kirche, vom Papst überrumpelt? Ein Titel zuwider, den er doch offenbar seit Jahren anstrebt?
Tatsächlich wird jene Weihnachtsmesse bis ins kleinste Detail mit Karl abgesprochen worden sein. Zwar sind genau jene Einzelheiten nicht überliefert, doch klar ist, dass Karl bewusst in Rom und zu Weihnachten den antiken Kaisertitel annimmt.
Anders jedoch als in der Antike spielt der Papst bei der Kaiserkrönung nun eine herausragende Rolle: Kaisertum und Papsttum ketten sich an diesem Wintertag für Jahrhunderte aneinander. Beide, der Kaiser wie der Papst, sind fortan, zumindest in der Theorie, die Köpfe der Christenheit – und auch der eigentlich weltliche Herrscher durch sein Amt aus dem normalen Irdischen hinausgehoben und in eine sakrale Aura gehüllt.
Aber kann ein Leib zwei Köpfe tragen? Sind Kaiser und Papst gleichrangig?
Ist nicht der Papst, wie jeder andere Bischof in Karls Reich, dem Herrscher letztlich Gefolgsamkeit schuldig? Oder muss nicht umgekehrt der Kaiser vor dem Papst das Haupt beugen, denn ist nicht der Nachfolger Petri der alleinige Herr der Kirche und der Kaiser bloß dessen mächtigster Diener?
Jahrhunderte werden über solche Dispute vergehen, Kriege werden geführt, Gegenpäpste eingesetzt werden, es wird der Fluch des gesamten Mittelalters: Kaiser oder Papst? Wem gebührt die höchste Macht?
Für Karl (und wohl auch für Leo) stellt sich diese Frage noch gar nicht: Der Papst ist froh, in seiner eigenen Stadt wieder sicher zu sein. Alles, was er hat, sein Amt, seine Würde verdankt er dem Franken.
Statt Soldaten schickt Karl fortan Paragrafen
Der Herrscher aus dem Norden wiederum ist auf dem Zenit abendländischer Größe. Fortan führt er den Titel: “Karolus, durchlauchtigster Augustus, von Gott gekrönter, großer, friedebringender Kaiser, das Reich der Römer lenkend, der auch durch die Barmherzigkeit Gottes König der Franken und Langobarden ist.” Karl hat etwas Neues geschaffen, das mittelalterliche Kaisertum. Doch er selbst sieht seine Schöpfung womöglich ganz aufrichtig nicht als etwas Neues, sondern als Wiederaufrichtung des Alten: Renovatio imperii Romanorum werden schon Zeitgenossen dies nennen, die Erneuerung des römischen Imperiums im Westen.
Und Karl macht sich nun auch jenseits aller Symbolik daran, das Reich zu renovieren. Statt Soldaten schickt der Herrscher fortan Paragrafen. Vorschriften regnen auf die Untertanen herab. Mit ihnen will der Herrscher “Fehlendes ergänzen, Widersprechendes ausgleichen und alles Falsche und Verkehrte verbessern”, wie Einhard lobt.
Aber kümmern sich die Grafen in den Pyrenäen oder in Friesland um das, was der mit den Jahren hinfälliger werdende Kaiser in Aachen dekretiert?
Niemand weiß es. Doch Karl selbst wird wohl ahnen, auf wie tönernem Sockel sein Kaiserthron steht. Im Frühjahr 801, als Karl noch im Land weilt, erschüttert ein Erdbeben Italien, das Dach der Basilika Sankt Paul in Rom stürzt ein. Ein böses Omen?
“Pestilenz”, so notieren die Reichsannalen, verheert im selben Jahr die Gegenden entlang des Rheins. An den Küsten von Nordsee und Atlantik tauchen urplötzlich “Nordmänner” auf: Wikinger, deren Raubzüge seit 799 ins Frankenreich führen. Karl lässt bald darauf in Flussmündungen und Häfen Wachposten stationieren, die vor herannahenden Wikingern warnen sollen. Dennoch überfallen die skandinavischen Krieger mit ihren schnellen Drachenbooten immer wieder fränkische Siedlungen an den Küsten und Flussläufen.
Der Tod holt sich Karls Familie. Die letzte der Ehefrauen ist schon vor der Kaiserkrönung ins Grab gesunken. In den folgenden Jahren stirbt der Vertraute Alkuin, die Äbtissin Gisela als letzte aller Geschwister Karls, es stirbt eine Tochter und dann einer der erbberechtigten Söhne, mit 33 Jahren, und dann noch einer und dann auch Pippin der Bucklige, der ins Kloster Verbannte.
Im Jahr 810, auf einem Feldzug gegen den Dänenkönig, stürzt Karl vom Ross. Ein epileptischer Anfall? Womöglich. Dem König mag das Unglück wie die Botschaft eines strafenden Gottes vorkommen. Wird er vermutlich doch unweit von ebenjenem Ort niedergestreckt, an dem er fast 30 Jahre zuvor Tausende aufständischer Sachsen hat töten lassen: nahe der Mündung der Aller in die Weser bei Verden. In den Jahren nach seinem Sturz wird Karl, so berichtet Einhard, immer wieder von Fieber geschüttelt und verlässt kaum noch seine geliebte Aachener Pfalz.
Dort stirbt er am 28. Januar 814, nachdem er mehr als 46 seiner annähernd 66 Lebensjahre mit Schwert und Pergament, mit Hinterlist und Bildungsgier geherrscht hat. Noch auf dem Sterbelager kreuzt er angeblich mit letzter Kraft selber die Arme über der Brust zur Todesgeste: ein souveräner Herrscher bis zum letzten Atemzug.
Sein Leichnam wird in jener Kirche bestattet, die Karl als Abbild des heiligen Jerusalem in Aachen hat errichten lassen. Dort ruht er in einem antiken Sarkophag, über dem sich ein goldener Bogen spannt. Eine Inschrift gedenkt des “großen und rechtgläubigen Kaisers, der das Reich der Franken edel erweiterte und durch 47 Jahre glücklich lenkte”.
Doch das Imperium, das Karl seinem einzig noch lebenden (und legitimen) Sohn Ludwig hinterlässt, ist zu groß für einen Mann mit bloß durchschnittlichen Qualitäten: Zu lang sind die Wege, einander zu fremd die vielen unterworfenen Völker, viel zu dünn ist die Elite der Gebildeten, die mit Verstand und kaltem Herzen ein solches Reich verwalten könnte.
Allein Karl hat es mit seinen außerordentlichen Fähigkeiten vermocht, dieses Imperium aufzubauen, zusammenzuhalten und, bei der Kaiserkrönung, zum Gipfel zu führen. In den Jahrzehnten darauf erschüttern Thronwirren, Rebellionen sowie die Teilungen unter den Erben – der ewige Fluch – das Land der Franken, das zudem unter den immer heftigeren Schlägen der Nordmänner erbebt.
Das Großreich zersplittert in drei Territorien, es kommt zu weiteren Intrigen und Machtkämpfen; Grenzen werden gezogen und wieder verschoben – bis Karls Imperium schließlich nur noch eine ferne Erinnerung ist.
Doch eine Hinterlassenschaft von Karl überstrahlt diesen politischen Verfall: sein Mythos. Nachfolgende Generationen werden den Frankenkönig, der zum Kaiser aufstieg, als idealen christlichen Herrscher verklären und ihn als Vorgänger und Vorbild verehren. Kurz: als Karl den Großen.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: