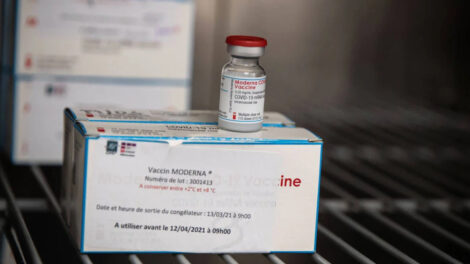Die depressiven Symptome in der deutschen Bevölkerung haben enorm zugenommen. In unteren Bildungs- und Einkommens-Schichten ist es am deutlichsten. Woran liegt es: An Existenzängsten, Kriegsängsten, Migrationsauswirkungen?
von Wolfgang Meins
Im Deutschen Ärzteblatt erschien kürzlich (Heft 21) eine durchaus interessante epidemiologische Längsschnittstudie, die einen Zeitraum von immerhin fünf Jahren abdeckt und einige unerwartete Ergebnisse zutage fördert. Auf Grundlage einer repräsentativen Stichprobe der erwachsenen deutschen Bevölkerung geht es in dieser Studie um die Entwicklung der sogenannten depressiven Symptomlast über einen Zeitraum von fünf Jahren, genauer: um die Veränderung der zwei depressiven Kernsymptome depressive Stimmung und Interessenverlust über die Zeit. Dazu wurden vom Robert Koch-Institut und der Medizinsoziologie der Berliner Charité von April 2019 bis Februar 2024 in monatlichen Abständen telefonische Interviews durchgeführt. Von besonderem Interesse war dabei, wie sich Einkommen und Schulbildung – jeweils aufgeteilt in niedrig, mittel und hoch – auf die depressive Symptomatik der Befragten auswirken. Wobei bekannt und allgemein akzeptiert ist, dass geringe Schulbildung und – davon ja nicht ganz unabhängig – ein vergleichsweise niedriges Einkommen jeweils mit dem häufigeren Vorkommen von depressiven Störungen assoziiert sind.
Monatlich wurde eine Zufallsstichprobe zwischen 1.000 und 4.000 Erwachsenen – insgesamt über die fünf Jahre gut 95.000 Personen – zu Einkommen und Schulbildung sowie zur Ausprägung der beiden oben genannten depressiven Kernsymptome befragt – von überhaupt nicht (0) bis beinahe jeden Tag (3) – und die Ergebnisse dann zu Quartalsdaten zusammengefasst. Erwartungsgemäß fällt der Schweregrad der beiden depressiven Symptome in den Gruppen mit geringer Bildung und niedrigem Einkommen durchgängig am höchsten aus. Ebenfalls durchaus erwartungsgemäß nimmt im Verlaufe der Coronazeit in allen Gruppen die depressive Symptomlast zu, um sich dann zwischen Mitte und Ende 2022 – in den Gruppen mit mittlerer und hoher Bildung – auf knapp 22 Prozrnt beziehungsweise 11 Prozent einzupendeln.
Damit kehrt die depressive Symptomlast aber bei Weitem nicht auf das Vor-Corona-Niveau zurück, sondern verharrt bis zum Ende der Erhebung auf einem jetzt etwa jeweils doppelt so hohen Niveau. In der Gruppe mit niedriger Bildung kommt es nach Ende der Coronazeit zu einer kurzfristigen Stabilisierung, gefolgt von einem erneuten Anstieg. Anfang 2024 liegt bei 29 Prozent der Gruppe mit niedriger Bildung eine relevante depressive Symptomlast vor, die allerdings nicht einfach mit einer auch klinisch behandlungsbedürftigen depressiven Störung gleichgesetzt werden darf.
In Bezug auf die drei Einkommensgruppen bietet sich ein ähnliches, aber noch deutlicheres Bild: Auch hier steigt nach Ende des Corona-Regimes der Trend bei der depressiven Symptomlast in der Gruppe mit niedrigem Einkommen weiter an, nämlich auf 33 Prozent. Außerdem zeigt auch die Gruppe mit mittlerem Einkommen nach scheinbarer Stabilisierung Anfang 2023 wenige Monate später wieder einen Anstieg bis auf 22 Prozent. Selbst die Gruppe mit hohem Einkommen hat zum Ende der Erhebung mit knapp acht Prozent „Depressiven“ nicht wieder das Ausgangsniveau von sechs Prozent erreicht, sich aber vom Höchststand während der Coronazeit (knapp 12 Prozent) doch recht deutlich erholt.
Unterm Strich hat also in allen drei Bildungs- und in allen drei Einkommensgruppen von 2019 bis Anfang 2024 der Anteil derjenigen mit relevanter depressiver Symptomatik zugenommen. Dabei gilt: Je geringer die Bildung und je niedriger das Einkommen, umso stärker die Zunahme des Anteils der „Depressiven“. Die Autoren weisen noch darauf hin, dass die absolute Ungleichheit – also die Anteilsdifferenz zwischen niedrigster und höchster Bildungs- bzw. Einkommensposition – von 10 beziehungsweise 12 Prozentpunkten im Jahr 2019 auf 22 beziehungsweise 30 Prozentpunkte 2024 zugenommen hat.
Erklärungen: Mangelware
Überzeugende Erklärungen für diese Ergebnisse bzw. die überwiegend deutliche Zunahme von Depressivität in dem untersuchten Fünfjahreszeitraum können die Autoren – da von ihnen nicht speziell untersucht – naturgemäß nicht liefern. Als mögliche Erklärungen weisen sie aber auf das „Auftreten zusätzlicher kollektiver Stressoren“ während des Untersuchungszeitraums hin. Gemeint sind damit Russlands Angriff auf die Ukraine und die „ab 2022 verstärkten Preissteigerungen für Haushaltsenergie und Nahrungsmittel“, die von Haushalten mit geringem Einkommen weniger gut kompensiert werden können. Eine Relevanz dieser beiden Erklärungsansätze soll hier nicht grundsätzlich in Abrede gestellt werden, allerdings dürften sie doch etwas zu kurz greifen.
Vielleicht hilft bei der Suche nach Erklärungen beziehungsweise weiteren „kollektiven Stressoren“ ja ein verwandtes Thema weiter, nämlich Angst. Schließlich gibt es bedeutsame Gemeinsamkeiten von Angst und Depression. Die KI führt zu den Gemeinsamkeiten aus: „eine überlappende Symptomatik wie Unruhe und Antriebslosigkeit, eine gemeinsame neurobiologische und genetische Grundlage sowie das häufige gemeinsame Auftreten. Viele Menschen mit Depressionen erleben auch Angstzustände, und umgekehrt können Angststörungen zu depressiven Symptomen führen.“ Treffender hätte auch ich es, zumindest in dieser Kürze, nicht formulieren können.
Die Ängste der Deutschen
Werfen wir also einen kurzen Blick auf die R+V Angststudie 2025, deren Datenerhebung allerdings erst ab Mai 2025 erfolgte, also ein gutes Jahr nach Abschluss der oben dargestellten Depressivitäts-Langzeitstudie und damit auch nach der Bundestagswahl im Februar diesen Jahres. Die Angststudie überrascht gleich mit einem unerwarteten Ergebnis: Fast alle Sorgen der Deutschen sind leicht gesunken. Im Vergleich zu 2024 ging der sogenannte Angstindex von 42 auf 37 Prozent zurück, das zweitniedrigste Ergebnis in der langjährigen Geschichte dieser Erhebung. Und natürlich bieten die Verantwortlichen auch eine Erklärung für dieses doch eher unerwartete Ergebnis, nämlich: „Die Menschen werden ständig mit multiplen Krisen konfrontiert, denen sie ohnmächtig gegenüberstehen. Die Deutschen haben sich an diesen Zustand gewöhnt, sie sind krisenmüde.“ OK, bisschen dünn, aber kann man diskutieren und um einen Gedanken ergänzen: Die Angst ist teils einer resignativen Depressivität gewichen.
Was sind nun die drei Topängste der Deutschen? Auf Platz 1, gewählt von immerhin 52 Prozent, liegt die Angst vor „steigenden Lebenshaltungskosten“, auf Platz 2 und 3, mit je 49 Prozent, die Angst vor der „Überforderung des Staates durch Geflüchtete“ und vor „Steuererhöhungen und Leistungskürzungen“. Nur der Vollständigkeit halber: Die Angst, Deutschland könnte im Ukrainekrieg selbst zur Kriegspartei werden, rangiert auf Platz 9, und – um mal was Erfreuliches zu berichten – die Angst vorm Klimawandel bzw. dessen Folgen liegt abgeschlagen auf Platz 16 der Angsthitliste. Angesichts der Klimakrisen-Dauerpropaganda ein doch wohl bemerkenswertes Resultat.
An der Vermutung, dass die steigenden Lebenshaltungskosten eine Ursache des Depressivitätsanstiegs sind, könnte also durchaus etwas dran sein. An den Themenkomplex Migration und Migranten oder Überforderung des Staates durch Geflüchtete haben, wenn auch nur im Geheimen, sicherlich auch die Autoren der Depressivitätsstudie gedacht. Denn schließlich wird nicht nur der Staat durch „Geflüchtete“ überfordert, sondern auch der Bürger, und zwar in Abhängigkeit von Alter, Wohnort, Einkommen und Tätigkeit.
Bereits im Sommer letzten Jahres hatte ich mich mit diesem Thema einschließlich des Totalversagens der Psychiatrie näher beschäftigt. Trotz intensiver Recherche bei Google und seinem wissenschaftlichen Ableger Google Scholar war es mir nicht gelungen, auch nur einen einzigen Treffer zu landen, egal unter welchen Suchbegriffen: Psychische Störungen bei Autochthonen durch Migration oder Psychische Belastungen von Deutschen durch muslimische Migration oder Führt Migration zu psychischen Problemen bei Deutschen oder auch der einheimischen Bevölkerung. Auch wenn ich jetzt den Suchbegriff psychische Störungen durch Depression ersetzte, blieb das Ergebnis frustrierend, nämlich ohne einen einzigen Treffer! Stattdessen erhielt ich natürlich – und zwar geradezu penetrant – immer wieder die ganze Palette von Arbeiten, in denen es um das psychische Leid der hiesigen Migranten geht.
Auch der KI fehlt, allerdings nicht ganz unerwartet, hier der Durchblick. Sie bläst schlicht in das gleiche Horn, sozusagen als „Her Masters’s Voice“: Auf die Frage: Gibt es psychische Probleme durch Migranten oder Migration bei Deutschen? lautet die Antwort folgendermaßen: „Es gibt keine Belege dafür, dass die Anwesenheit von Migranten bei der deutschen Bevölkerung pauschal psychische Probleme verursacht, jedoch kann die Migration-assoziierte Debatte und die damit verbundenen gesellschaftlichen Spannungen individuelle Belastungen und Ängste auslösen, insbesondere bei Menschen mit Unsicherheiten oder Abwertungserfahrungen.“ Verstanden! Wir müssen nur endlich mit dieser Debatte aufhören, dann wird alles gut.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: