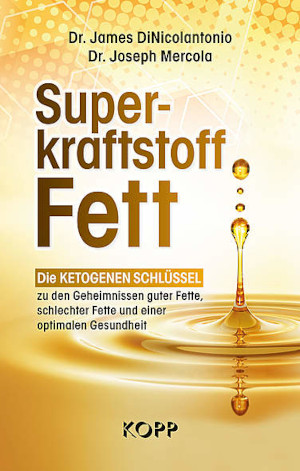Fett gilt als Dickmacher, Verursacher etlicher Leiden und – einmal angehäuft – als Problemzone des Menschen. Über das Thema ist sehr viel Desinformation im Umlauf. Welche sollten Sie essen? Welche sind schlecht für Ihre Gesundheit? Und vor allem: Warum ändern sich ständig die Empfehlungen?
von Sebastian Witte
Einmal im Jahr begeht das im Tschad lebende Volk der Massa ein bizarr anmutendes Ritual: Acht Wochen lang ziehen sich einige Männer des Stammes in karge Hütten zurück, um den eigenen Körper – fast gänzlich abgeschottet von der Außenwelt – regelrecht zu mästen.
Insgesamt elf Portionen, meist Hirsebrei und fette Milch, müssen die Teilnehmer der Zeremonie täglich vertilgen. Mancher schafft es, innerhalb von 24 Stunden fast sieben Kilogramm dieser Spezialnahrung zu sich zu nehmen. Das entspricht im Mittel etwa 13 000 Kilokalorien (rund fünfmal so viel wie der eigentliche Tagesbedarf). Vermutlich verspeisen kaum irgendwo sonst auf der Welt Menschen in so kurzer Zeit derart viel Kost.
Schönheit, Status – und Zweck: Warum Fett für die Massa so wichtig ist
Mit Magenkrämpfen und Brechattacken wehrt sich der Körper der Massa-Männer zunächst gegen die vielen Mahlzeiten, doch allmählich bewirkt die Überdosis Essen vor allem eines: dass sie immer dicker werden.
Denn die Energie, die sie sich einverleiben, speichern sie größtenteils in Form von Fett. Immer mehr davon lagert ihr Körper in speziellen Depots ein, lässt Arme, Beine, Bauch, Gesäß und Gesicht anschwellen. Bis zu 35 Kilogramm legen manche der Männer im Laufe der zwei Monate währenden Kalorien-Kur zu. Nach der Prozedur kehren sie in ihre Familien zurück und werden fortan geradezu verehrt: Leibesfülle gilt unter den Massa als Schönheitsideal und Statussymbol, sie führt zu Anerkennung und sexueller Attraktivität.
Trotzdem lassen sie den Brauch – wenn überhaupt – meist nur ein einziges Mal über sich ergehen. Denn für die Massa ist das Fettwerden vor allem eine Art Initiationsritus, dem sich hauptsächlich Jüngere unterziehen (die dann nach und nach auch ihr Normalgewicht zurückerlangen).
Ein Speicher fürs Überleben: Fett als evolutionärer Vorteil
Was viele Europäer befremden mag, ergibt für die noch heute eher traditionell lebenden Bewohner Zentralafrikas durchaus einen Sinn. Denn wer in Zeiten der Dürre schwergewichtiger ist als andere, verfügt über einen Vorrat an Zehntausenden Kilokalorien, auf den er zurückgreifen kann, wenn die Nahrung einmal knapp sein sollte.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte galten prall gefüllte Depots auch in unseren Breiten als Unterpfand für die Existenz, halfen Hungersnöte und lange Winter zu überwinden und entsprachen dem gängigen Schönheitsideal.
Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts – seit Nahrung zumindest in den Industrienationen stets in ausreichender Menge verfügbar ist – scheint sich der Überlebensvorteil reichhaltiger Fettreserven in sein Gegenteil verkehrt zu haben. Und haftet der Speichersubstanz Fett nun der Ruf an, dem Menschen eher zu schaden als zu nützen.
Doch jedermann braucht den Stoff. Auch wenn wir in der modernen Gesellschaft längst keine Mangelzeiten mehr erdulden müssen, sind wir auf Fettvorräte angewiesen. Denn die Reserven sind durchaus kein träges Energielager. Vielmehr dirigiert das Fettgewebe wichtige Vorgänge im Körper, beeinflusst entscheidende Funktionen wie Fortpflanzung, schützt uns vor Krankheit.
Das Fett ist also nicht zwangsläufig eine Problemzone des Menschen – sondern ein äußerst vielseitiges Gewebe. Schon früh in der Geschichte des Lebens hat die Natur diese Speichersubstanz hervorgebracht. Vermutlich verfügten bereits die ersten Säugetiere, die sich vor mindestens 200 Millionen Jahren entwickelten, über die Fähigkeit, winzige Fetttröpfchen zur Wärmeregulierung einzulagern.
Denn anders als Amphibien oder Reptilien mussten sie ihre Körpertemperatur konstant halten und benötigten dafür beständig Energie. Vor allem größere Arten, die bei der Suche nach Nahrung nicht immer erfolgreich waren – so jedenfalls vermuten Forscher heute –, legten sich daher Fettreserven an, auf die sie in Mangelzeiten zurückgreifen konnten.
Vom Hunger zur Hochform: Warum der Mensch so viel Fett speichert
Nur wenige Landsäuger vermochten die Depots jedoch so effizient aufzubauen wie der Homo sapiens, der vor rund 200 000 Jahren entstand – kein anderer Primat ist in Bezug auf seine Körpergröße so fett wie er. Dazu ist es vor allem deshalb gekommen, weil der moderne Mensch im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte von Versorgungsengpässen weit häufiger bedroht war als viele andere Tiere.
Zwar standen unseren Vorfahren als Allesfresser prinzipiell eine Vielzahl von Nahrungsquellen zur Verfügung; dennoch mussten sie mitunter Tage oder Wochen durch die Savanne streifen, bis sie ein Wildtier erlegten oder einen Strauch mit reifen Beeren fanden – und sich die nächste größere Portion Essen einverleiben konnten. Als besonders erfolgreich erwiesen sich daher jene Jäger und Sammler, die imstande waren, Kalorien in großen Mengen zu speichern und bei Bedarf wieder zu mobilisieren. Das Einlagern von Fett war dafür ideal – ein Gramm der Substanz enthält neun Kilokalorien. Aus keinem anderen Stoff lässt sich mehr Energie gewinnen.
Noch heute ist der Menschenleib daher eine gewaltige Lagerstätte für Fett. Selbst ein schlanker, 1,80 Meter großer Mensch von 70 Kilogramm Gewicht trägt durchschnittlich etwa ein Fünftel seines Gewichts in Form von Fett mit sich herum, also rund 14 Kilogramm. Es umhüllt seine Organe, befindet sich sogar an der Ferse, in den Wangen und hinter den Augen; es sammelt sich am Gesäß an, in den Beinen oder rund um die Taille.
Der Zelltyp, der uns rund macht: Was Adipozyten wirklich leisten
So unterschiedlich der Depotstoff aber auch verteilt ist – stets setzt er sich aus dem gleichen Zelltyp zusammen, dem Adipozyten. Je nach Leibesumfang finden sich etwa 40 bis 120 Milliarden dieser Zellen im Körper eines Erwachsenen – das sind mindestens zehnmal so viele Fettzellen wie bei den meisten Wildtieren vergleichbarer Körpergröße.
Programmiert auf Speicherung, füllen sich die Adipozyten nach und nach mit jenen Grundbausteinen, aus denen Fett besteht: den Fettsäuren. Je drei von ihnen bauen sie zu einem sogenannten Triglycerid zusammen, einem winzigen Fettmolekül, das die Zellen einlagern. Dabei blähen sie sich auf und können bis auf ein Vielfaches ihres ursprünglichen Ausmaßes heranwachsen. Damit zählen Adipozyten zu den größten Zellen des Körpers.
Die eingelagerten Triglyceride stammen entweder aus den Fetten in der Nahrung selbst, also aus Ölen, Butter oder etwa tierischem Speck. Doch der Körper kann sie auch aus überschüssigen Kohlenhydraten gewinnen. Und ob jemand dick oder dünn ist, hängt einerseits vom Füllstand seiner Fett speichernden Zellen ab, andererseits von deren Menge: Sind sämtliche Adipozyten prall gefüllt, beginnt unser Körper, neue zu produzieren – um noch mehr Energie einzulagern, vor allem in der Bauchgegend, an Oberschenkeln oder Hüfte.
Chemiefabrik im Körper: Wie Fettzellen mit dem Gehirn kommunizieren
Dieser Mechanismus hat sich aber keineswegs nur deshalb durchgesetzt, weil die gefüllten Adipozyten den Körper bei temporärer Nahrungsknappheit schützen. Vielmehr hat sich das Speicherfett im Verlauf der Evolution zu einer der wichtigsten Komponenten der menschlichen Biologie entwickelt.
Zwar wirkt das weißliche Gewebe, mit bloßem Auge betrachtet, relativ unscheinbar. Doch im Verborgenen entfaltet es eine ungeahnte Macht. Denn die Zellen, aus denen das Fettgewebe besteht, gleichen regelrechten Chemiefabriken, die massenhaft Botenstoffe und hormonähnliche Substanzen produzieren und in den Blutstrom entsenden. Mehr als 100 dieser Signalstoffe sind bisher bekannt.
Als Signalgeber operieren diese Substanzen in einem fein verzweigten Kommunikationssystem, in dem sie permanent Nachrichten zwischen Zellen und Organen übermitteln. So beeinflussen sie eine Vielzahl biochemischer Prozesse im Körper. Mithilfe des Botenstoffes Leptin etwa informiert das Körperfett das Gehirn über den Füllstand seiner Zellen: Füllen sich die Kammern, schüttet es diese Substanz vermehrt aus und sorgt so dafür, dass unser Hungergefühl nachlässt. Sinkt die Konzentration des Hormons im Blut binnen weniger Stunden ab, bekommen wir automatisch Appetit. Bei Übergewichtigen zirkuliert zehnmal so viel Leptin im Blut wie bei dünnen Menschen – und doch haben sie meist trotzdem noch Hunger. Forscher vermuten, dass sie im Gehirn eine Resistenz gegen das Hormon entwickelt haben.
Hormone, Fruchtbarkeit, Schutz: Was Fett alles für uns tut
Leptin steuert zudem etliche weitere Körperfunktionen. So entscheidet es maßgeblich darüber, ob Frauen schwanger werden können oder nicht: Denn erst wenn der Fettanteil im weiblichen Körper einen bestimmten Mindestwert erreicht hat, also eine gewisse Konzentration des Botenstoffes im Organismus zirkuliert, ist die Gebärmutter bereit für den monatlichen Eisprung. Studien zeigen, dass der weibliche Organismus mindestens zu einem Fünftel aus Fett bestehen muss, damit die Regelblutung einsetzt. Daher kann es vorkommen, dass die Menstruation bei Magersuchtkranken oder Leistungssportlerinnen ausbleibt, die nur über wenig Körperfett verfügen.
Wenn der Menstruationszyklus um das 50. Lebensjahr zu Ende geht, übernehmen die Fettzellen erneut eine bedeutsame Funktion. Denn nachdem die weiblichen Eierstöcke ihre Botenstoffproduktion weitgehend eingestellt haben, vermag nur noch das Körperfett das weibliche Geschlechtshormon Östrogen herzustellen.
Zudem schützt diese Substanz die Knochen im Körper alternder Menschen (auch im Fett der Männer entsteht Östrogen) vermutlich vor übermäßigem Abbau und sorgt so für ein stabiles Skelett. Doch noch entscheidender ist, dass das Fettgewebe vor allem als Partner unserer Immunabwehr besondere Kräfte entfaltet. Dringen Krankheitserreger etwa durch die Schleimhäute des Darms in den Organismus ein, sondern sie vermutlich bestimmte Moleküle ab. Diese können die Fettzellen wahrnehmen und daraufhin eine Reihe spezieller Eiweißstoffe entsenden, die im umliegenden Gewebe stationierte Abwehrzellen alarmieren.
Wenn Fett Leben rettet – und warum sein Fehlen gefährlich ist
Vom Fett in Kampfbereitschaft versetzt, verleiben sich die Schutztruppen daraufhin die Angreifer ein oder zerstören sie mit Gift. Ohne die Aktivität des Fetts wären wir also stärker von Eindringlingen bedroht, könnten uns Keime leichter befallen. Das zeigt sich unter anderem bei Hungersnöten: Deren Opfer sterben häufig nicht am Ernährungsmangel, sondern viel eher an Infektionen, wie etwa einem Grippevirus, denen der geschwächte Körper aufgrund fehlender Fettreserven schlicht nicht mehr gewachsen ist.
Doch wenn Fett für den Menschen so wertvoll ist, wieso ist es dann in den vergangenen Jahrzehnten so in Verruf geraten? Die Antwort der Forscher: Bei gefährlich hohem Übergewicht, also einem Körperfettanteil ab 35 Prozent bei Frauen und 25 Prozent bei Männern, können uns die Depots auch zum Verhängnis werden.
Es mag paradox erscheinen, doch ebenjenes enge Zusammenspiel zwischen dem Körperfett und der Immunabwehr, das unser Überleben erst möglich macht, gerät dann aus dem Takt. Gewissermaßen wird der Freund, der den Feind bekämpft, dann selbst zu unserem Gegner.
Entzündung, Diabetes, Infarkt: Wenn Fett das Immunsystem fehlleitet
Das liegt daran, dass aufgedunsene Fettzellen weit mehr Alarmstoffe produzieren als solche, die nur mäßig gefüllt sind. Unentwegt schütten sie die Substanzen in die Blutbahn aus und locken dadurch massenhaft Fresszellen des Immunsystems an – auch dann, wenn gar keine Eindringlinge zu attackieren sind. Einmal aktiviert, greifen die Abwehrtrupps dann das eigene Gewebe an. Dabei können unter anderem Ablagerungen an den Wänden der Blutgefäße entstehen. Bildet sich dort ein Gerinnsel, reißt es sich womöglich los und führt zu Verstopfungen – Herzinfarkt oder Schlaganfall sind im schlimmsten Fall die Folgen.
Der permanente innere Entzündungszustand, den die überreizten Fettzellen hervorrufen, kann auch zu Diabetes mellitus führen, bei dem sich mit der Zeit die Insulin herstellenden Zellen der Bauchspeicheldrüse erschöpfen. Ohne dieses Hormon aber gelangt kein Zucker mehr in die Körperzellen, und der Mensch stirbt an Auszehrung (falls er das Insulin nicht künstlich erhält).
Vor allem das Fett in der Bauchgegend ist für derartige Leiden verantwortlich. Denn es verhält sich weitaus aggressiver als andere Depots etwa in den Beinen oder nahe der Hüfte, stellt also besonders viele Entzündungsstoffe her und löst im Körper den größten Stress aus. Menschen mit übermäßig viel Bauchfett sollten deshalb unbedingt versuchen, den Füllstand ihrer Speicher zu reduzieren. Dazu müssen sie letztlich nur eines tun: über längere Zeit mehr Kalorien verbrauchen, als sie dem Körper in Form von Nahrung zuführen. Dann nämlich beginnen sich die Adipozyten allmählich zu entleeren und ihren Inhalt unter anderem den Muskelzellen zur Energiegewinnung zur Verfügung zu stellen.
Der Jojo-Effekt: Warum der Körper abgenommenes Fett zurückwill
Dass viele Abnehmversuche dennoch scheitern, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass unser Organismus einmal verlorene Reserven rasch wieder aufzufüllen versucht. Ein ganzer Cocktail an Botenstoffen etwa sorgt dafür, dass unsere Lust auf Essen nach einer Diät überproportional hoch ist und wir uns deutlich mehr Speisen einverleiben, als eigentlich nötig wäre. Regelmäßiges Fasten kann also paradoxerweise dazu führen, dass wir langfristig mehr zu- als abnehmen.
Hinzu kommt, dass es manchen Menschen von Natur aus schwer fällt, ihr Gewicht zu halten. Der Grund dafür, so nehmen viele Forscher inzwischen an, liegt vermutlich in ihrem Körperfett selbst. Denn neben den weißen, Fett speichernden Adipozyten verfügt der Mensch noch über eine zweite Form von Fettzellen, die gänzlich anders funktionieren. Sie enthalten eine Vielzahl von Mitochondrien – das sind Minikraftwerke, die Energie nicht einlagern, sondern Kalorien verbrennen und dabei Wärme erzeugen.
Wärme statt Speck: Was braunes Fett im Körper leistet
Dieses Gewebe, das Forscher aufgrund seiner dunkleren Färbung “braunes Fett” nennen, ist vor allem im Körper Neugeborener aktiv und soll verhindern, dass Säuglinge zu schnell auskühlen. Sinkt die Körpertemperatur der Babys, steigert das Gewebe automatisch seine Wärmeproduktion und schützt so vor Kälte.
Lange Zeit gingen Forscher davon aus, dass sich dieser sonderbare Fettzellentyp mit fortschreitendem Alter zurückbildet. Doch im Jahr 2009 gelang es mehreren Expertenteams, braunes Fettauch bei gesunden Erwachsenen nachzuweisen. Insbesondere schlanke Menschen verfügen über mehr Depots des körpereigenen Heizaggregats, vor allem in der Nackengegend und am Rücken.
Das bedeutet, dass sie automatisch mehr Kalorien verwerten können als jene, bei denen das Gewebe kaum oder gar nicht vorhanden ist. Schätzungen zufolge steigern bereits 50 zusätzliche Gramm braunes Fettgewebe im Körper den Energieverbrauch eines Erwachsenen so weit, dass er allein dadurch vier Kilo Fett im Jahr verbrennen kann.
Schlank durch Zellkraft
Es gibt also tatsächlich Menschen, denen es allein aus biologischen Gründen leichter fällt, schlank zu bleiben – ohne sich dafür besonders anstrengen zu müssen. Noch suchen die Forscher nach Wegen, wie sich das Potenzial des Stoffes bestmöglich nutzen lässt. Einige Wissenschaftler planen gar, braune Fettzellen im Labor zu züchten und in die Körper Schwergewichtiger zu transplantieren, um ihnen das Abnehmen dauerhaft zu erleichtern. Bisher haben sie die komplexe Physiologie der dunklen Gebilde noch nicht vollends entschlüsselt. Aber wer weiß: Vielleicht lassen wir uns eines Tages tatsächlich Fett einpflanzen, um Fett zu verlieren.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 107.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 107.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: