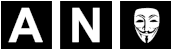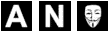Töpfern, Honig herstellen oder raffinierte Obstschnäpse brennen: Wer die Kraft der eigenen Hände nutzt, wird oft mit dem Gefühl tiefer Zufriedenheit belohnt
von Rainer Harf
enn Benjamin Wroblewski im Sommer aus der Schule kommt, zieht es ihn meist zuerst in den Garten. Der Lehrer aus Amelinghausen südlich von Hamburg setzt sich dann auf eine Bank und lauscht dem Summen, das aus den Bienenhäusern dringt. “Dann löst sich alle Anspannung”, sagt Wroblewski, die Hektik des Schulalltags klingt ab.
Mit den Bienen öffnet sich ihm und seiner Familie gleichsam eine Parallelwelt, ein Mikrokosmos, in dem alle Sinne gefordert sind. Im März oder April, je nach Witterung, werden die Insekten aktiv. Nun muss Wroblewski von Zeit zu Zeit die Kästen öffnen und die Holzrähmchen prüfen, in denen die Bienen ihre Waben bauen. Beschützt von dicken Handschuhen, greift er vorsichtig in die Bienenhäuser hinein, kontrolliert die Waben und entfernt einzelne Königinnenzellen.
Wer Menschen wie Wroblewski dabei beobachtet, wie sie mit eigenen Händen arbeiten, der kann oft sehen: Sie wirken wie entrückt, völlig eins mit ihrer Tätigkeit. Ob sie imkern, nähen oder stricken, feilen, hobeln oder malen: Es ist, als würde sie eine innere Freude erfüllen, eine Art Seligkeit. Als würde die Tätigkeit etwas anrühren, das tief in uns liegt. Ein Vergnügen, das mehr und mehr verloren gegangen ist, seit Menschen sich daran gewöhnt haben, fertige Produkte gegen Geld zu tauschen – doch es wird allmählich wiederentdeckt.
Anleitungen dazu, wie man pflanzt, backt oder braut, sind im Internet millionenfach zu finden. Näh-Kits und Bastel-Sets, Strickvorlagen, Rezeptbücher und Werkzeuge aller Art gibt es heute nicht mehr nur in Fachgeschäften. Und überall findet sich in Schaufenstern, auf Verpackungen und in Anzeigen der Slogan “Do it yourself”.
Spießer-Image? Dies hat das Selbermachen längst abgestreift
Anders als früher ist DIY (so die Kurzform) nicht mehr ein Mittel gegen Mangel: Höhere Einkommen und zunehmende Freizeit ermöglichen es vielen, daheim durchaus anspruchsvolle Arbeiten auszuführen, sich Werkstätten zuzulegen, die den Vergleich mit der Ausrüstung des Profis oft nicht scheuen müssen.
Begriffe wie urban gardening statt Schrebergarten oder maker space statt Hobbykeller haben dem Selbermachen das Spießer-Image genommen. Auch die einstigen Handwerksdomänen der Geschlechter – Frauen nähen, Männer bauen – öffnen sich allmählich. Zahlreiche Baumärkte veranstalten bestens besuchte Frauen-Workshops. Die Teilnehmerinnen lernen in einer “Women’s Night” unter anderem, wie man richtig dübelt, kachelt, lackiert, Laminat verlegt oder Wände verputzt.
Besonders beliebt ist der “Maschinenführerschein”, bei dem der Umgang mit Bohrhammer, Stichsäge oder einem Multifunktionsgerät geübt wird, das vorstehende Nägel absägt, Fugen auskratzt und Oberflächen schleift. Tausende Frauen nehmen jährlich an Hunderten Veranstaltungen teil, manche sind jünger als 20, andere älter als 70.
Die Freude am Selbermachen ist wieder da. Aber weshalb? Wieso gerade jetzt? Erklärt sich die wachsende Begeisterung für solche Arbeit dadurch, dass Menschen einen Gegenpol suchen zum modernen Alltag, in dem sie oft nur digitale Daten hin und her schieben? Speist sich der Trend zum eigenen Werk aus einer urmenschlichen, doch vielfach ungestillten Sehnsucht? Nämlich sagen zu können: “Das habe ich geschafft!” Oder ist die neue Vorliebe für das Selbermachen vielmehr ein Zeichen von Emanzipation und Autonomie?
Der Wunsch, Dinge selbst zu machen, ist schon alt
Gewiss ist: All das Backen und Häkeln, Zimmern, Töpfern und Einwecken greift auf Altes zurück und belebt es neu. Bis zum 19. Jahrhundert war es noch üblich, Dinge selbst anzufertigen. Doch mit der Industriellen Revolution und später mit dem Wirtschaftswachstum nach dem Zweiten Weltkrieg wurde alles anders. Weiterhin selbst zu schneidern oder zu zimmern – das zeugte von der Zeit, die man vergessen wollte. Wer sich etwas leisten konnte, war stolz auf Mode von der Stange und Möbel auf Raten.
Nach und nach erschien es altmodisch und irrational, selber zu nähen, Sessel zu tischlern, Bienen zu pflegen, Schälchen zu töpfern. Die Erfahrungen von früher, das Wissen um Handgriffe und Materialien, wurden immer spärlicher. Jede technische Errungenschaft in der Fabrikation entfernte den Einzelnen immer weiter von den Fähigkeiten, die Menschen über Jahrhunderte erworben hatten.
Der US-Soziologe Richard Sennett hat der alten Manufakturtradition in seinem Buch “Handwerk” ein Denkmal gesetzt. Er rühmt darin meisterliche Fertigkeit, die über Generationen weitergegebenen Geheimnisse von Kulturtechniken, die Hingabe und den Stolz, eine Arbeit so gut wie möglich zu tun. Vor allem aber, so schreibt er, gingen Hand und Kopf, Fertigkeit und Fantasie eine einzigartige Verbindung ein.
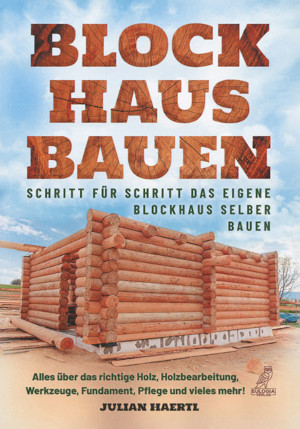
Als Erwachsene nehmen wir das Sehen weitaus wichtiger als den Tastsinn. Doch er ist der erste Sinn, den wir als Kind im Mutterleib ausbilden. Die gesamte Entwicklung des Organismus, des Bewusstseins hängt daher vermutlich eng mit dem Tastsinn zusammen – der Fähigkeit, mit den Händen zu spüren. Wenn wir als Kinder später beginnen, die Welt zu erforschen, dann tun wir nichts anderes als: sie begreifen. Die Hände dienen uns dazu, mit der Umgebung in Kontakt zu treten; nur mit ihrer Hilfe erkennen wir, wie kühl Metall ist, wie rau ein Ast, wie zart eine Blume.
Und doch müssen wir den Gebrauch der Hände erst mühsam schulen. Wenn ein Baby erstmals versucht, nach seinem Kuscheltier zu angeln, wenn es minutenlang gebannt die Bewegung der eigenen Hand verfolgt oder mit der Rechten nach der Linken greift, ist es dabei, die Koordination von Auge und Hand zu trainieren. Und ehe es einem Kind gelingt, einen rasch heranfliegenden Ball routiniert zu fangen, muss es mehrere Jahre lang üben.
Ebenso viel Zeit vergeht, bis es erkennt, wie vielfältig die Körperwerkzeuge sind. Hände können grob zupacken, aber auch feinmotorisch als Präzisionsinstrumente dienen. Damit das gelingt, braucht es eine Zentrale, die alle Informationen in Sekundenbruchteilen zusammenbringt und dann jene Impulse an die Muskeln sendet, die die Hand lenken. Zu diesem Zweck sind die Muskeln der Hand über eine Art neuronale Schnellstraße direkt mit jenem Teil des Großhirns verbunden, der die willentlichen, also von uns beabsichtigten Bewegungen steuert.
Die Signale, die dorthin gelangen, sind heute in der Regel aber weitaus weniger vielfältig als möglich. Hände sind zunehmend darauf reduziert, mit Tastaturen, Fernsteuerungen und Autolenkrädern zu hantieren, Schrauben nach Anleitung in vorgebohrte Löcher zu drehen – und mit den Fingerkuppen über Tablet- und Smartphone-Monitore zu wischen.
“Do it yourself” bringt Erfolgserlebnisse – und wir spüren uns selbst
Der DIY-Boom, so könnte man sagen, ist auch ein Protest gegen diese Degradierung der Hände – gegen die allgegenwärtige Aufwertung des Visuellen und Virtuellen. Und gibt auf diese Weise etwas zurück, was wir mehr und mehr zu verlieren drohen: ein Gefühl für uns selbst. Bei fertigen Produkten, vor allem aber bei digitalen und visuellen Medien erleben wir oft: Sie sind nicht gestaltbar, ja sogar nicht verstehbar. Bei einem TV-Gerät zum Beispiel lässt sich nicht mehr verändern als die Programmwahl, bei einem Smartphone nur die Auswahl der Hintergrundbilder und Apps.
Doch wenn wir mittels der Hände mit der Welt in Kontakt treten, selbst etwas gestalten, dann können wir vielfältige Erfolgserlebnisse sammeln. Mehr noch: Wir erleben, dass wir wahrhaftig als leibliches Wesen existieren – und etwas erschaffen können. Im Sommer kann der Hobbyimker Benjamin Wroblewski den Honig ernten: Vorsichtig entnimmt er die honigsatten Waben aus den Bienenkästen, streift die Bienen von den Zellen und schleudert die Holzrahmen in einer speziellen Zentrifuge. Heraus fließt schließlich das süße Gold.
Bienen und Imker haben im Laufe der Monate gemeinsam daran gearbeitet. Nicht selten hält Wroblewski am Ende einer Saison Dutzende Kilogramm Honig in den Händen. Sein ganz eigenes Produkt. Stolz kommt auf, Zufriedenheit – das Gefühl, etwas bewirkt zu haben.
Die Selbstwirksamkeit beim Selbermachen wirkt äußerst positiv
Psychologen betrachten diese Empfindung als fundamental wichtig für die geistige Gesundheit, für eine innere Ruhe, und haben ihr daher einen eigenen Begriff gegeben: Selbstwirksamkeit. Wer sie immer wieder in sich spürt (und sei es allein im Garten, im Hobbykeller oder in der Gruppe mit Gleichgesinnten), in dem kann auch die Gewissheit erstarken, das eigene Leben gestalten zu können – und nicht nur ein Spielball der gesellschaftlichen Umstände oder eines übermächtigen Schicksals zu sein.
Genau diese Gewissheit kann Selbstwirksamkeit mit sich bringen, ein tiefes Gefühl der Lebenszufriedenheit. Das hat mit dem Gehirn zu tun. Und ist bereits in der kindlichen Entwicklung bedeutsam: Angetrieben durch eigene Erfahrungen – durch Versuch und Irrtum –, wächst im Frontalhirn ein hochkomplexes Neuronennetz heran.
Um ihr Verständnis von der Welt zu erweitern, müssen Kinder neue Wahrnehmungen in einen sinnvollen Kontext einbetten. Unser Gehirn kann nämlich nur dann etwas lernen, wenn es die neuen Eindrücke an ein bereits vorhandenes Muster anhängen kann, das sich durch frühere Erfahrungen ausgebildet hat. Das ist ein hochkreativer Prozess. Das Kind versucht also, das Neue in das Alte einzufügen. Dafür wühlt es gewissermaßen zunächst in seinem Hirn herum. Eine produktive Unruhe entsteht, bis das Erregungsmuster plötzlich passt. Dann verwandelt sich das Chaos im Gehirn in Harmonie – ein Aha-Erlebnis entsteht.
Flow-Erlebnisse begünstigen das Selbermachen
Und dabei wird das Belohnungszentrum aktiv. Nervenzellen schütten sogenannte Glückshormone aus. Jedes in eigener Leistung erbrachte Erfolgserlebnis wirkt so beglückend, als hätte man eine kleine Menge Drogen genommen. Genau dieser Vorgang kann sich in jedem Lebensalter vollziehen. Wer sich also auf die Suche nach solchen Erfolgserlebnissen macht, der erlebt dann oft ein Gefühl der scheinbar zeitlosen Erfüllung und Genugtuung: Alles scheint in wohltuendem Fluss zu sein.
Inzwischen hat sich dafür der Begriff “Flow” etabliert. Es ist der Rausch einer perfekten Choreografie im Gehirn. Eine US-Psychologin hat untersucht, was im Gehirn von Menschen geschieht, die Flow-Erlebnisse haben. In einer umfangreichen Laborstudie sollten sich Probanden auf Töne oder künstlich erzeugte Lichtblitze konzentrieren. Währenddessen wurde gemessen, wie die Großhirnrinde die optischen und akustischen Reize verarbeitet.
Das Resultat: Je intensiver sich jene Testpersonen, die schon häufig Flow-Erlebnisse gehabt hatten, konzentrierten, desto stärker sank die Aktivität in der Großhirnrinde – jenem Teil des Denkorgans, der unter anderem das menschliche Bewusstsein erzeugt. Diese Versuchsteilnehmer waren offenbar fähig, die geistige Aktivität in fast allen Informationskanälen herunterzufahren – bis auf ebenjenen Kanal, der die Lichtblitze oder die Töne verarbeitete.

Die Gehirne jener Probanden dagegen, die angaben, nur selten ein ”Gefühl des Fließens” erlebt zu haben, offenbarten ein anderes Bild. Während des Experiments arbeitete ihre Großhirnrinde weitaus stärker. Sich zu konzentrieren verlangte ihnen demnach mehr geistige Arbeit ab. Um immer wieder Glücksmomente bei einer Tätigkeit zu erleben, so die Folgerung der Forscherin, ist es nötig, energiesparend zu denken und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu richten.
Gerade das kann uns beim Selbermachen besonders leichtfallen: Die selbst gestellte Aufgabe ist dann überschaubar, verlangt nur das, was wir selbst bereit sind einzusetzen. Oft gibt sie uns sogar mehr Energie, als sie uns raubt. Aber es ist nicht nur das persönliche Wohlbefinden, das viele beim Selbermachen erleben. Wer etwas eigenhändig macht, ist oft auch unzufrieden mit Produzenten, die mit Worten wie “effizient, schnell und billig” werben. Das private Aufbegehren dagegen mag manches Mal hilflos wirken, aber es zeigt ein Unbehagen an einer Wirtschaft, die immer schneller immer mehr Ware zu immer niedrigeren Preisen um den Erdball schickt. Das Herstellen, so der britische Soziologe David Gauntlett, gebe den Menschen das verloren gegangene Gefühl zurück, die Welt mitzugestalten.
Vom Konsumenten zum Produzenten
Es ist das Anzeichen eines Wandels, den Wissenschaftler beobachten: Mehr und mehr Menschen in hochtechnisierten Ländern begnügen sich nicht länger damit, Nutzer einer Produktion zu sein, Verbraucher. Sie möchten auch an der Produktion eines Guts beteiligt sein, ein Stück weit selbst zum Hersteller werden. Sie sind also weder ganz “Konsument”, noch “Produzent” – sondern “Prosumenten”, so der von dem US-Futurologen Alvin Toffler geprägte Begriff. Prosumenten kaufen Produkte, aber auch Materialien oder Rohstoffe, um aus ihnen freiwillig und unentgeltlich selbst Produkte herzustellen.
Eine Veränderung des Konsumverhaltens kann man in Deutschland etwa in Repair-Cafés beobachten, in denen Widerwille gegen die Wegwerfgesellschaft auf eine neue Lust an Gemeinsinn trifft. Dort helfen versierte Bastler handwerklich Unbegabten, defekte Geräte zu reparieren, Fahrräder zu flicken, Kleidung zu gestalten. Zahlen muss niemand; Spenden für das Projekt aber werden nicht abgelehnt.
Doch nicht immer geht es ums Reparieren, manches Mal auch um kreatives, spielerisches Erfinden von Neuem: Allerorten boomen work spaces und fab labs. Sie bieten gegen geringes Entgelt Arbeitsplätze und Infrastruktur für Menschen, die Lust am gemeinsamen kreativen Tun haben und dafür Geräte benötigen, die sie sich allein nicht leisten könnten – etwa Laser-Cutter, Gravurmaschinen oder 3-D-Drucker. Allein in Berlin gibt es inzwischen rund 100 dieser Orte für kreatives Arbeiten und Experimentieren mit der Vision: neue Freiräume, mehr Gemeinschaftsgefühl, weniger einsame Weltentfremdung. Sie tragen Namen wie “Kulturschöpfer”, “Social Impact Lab” oder “Trial & Error Kulturlabor”. Es sind Experimentierräume, die ahnen lassen, dass das kleinteilige Wirtschaften eine Zukunft haben wird.
Und das Internet erweitert die Möglichkeiten. Freunde der sogenannten Open Source Ecology stellen etwa Bauanleitungen für Windräder und Landmaschinen ins Netz. Jeder kann sie nutzen, seinen Bedürfnissen anpassen und verbessern. Denn Do it yourself hat inzwischen nicht mehr nur mit physischer Aktivität zu tun. Analog und digital ergänzen sich. Selbermachen kann auch heißen: ein Programm zu schreiben, das der Fräse sagt, was sie zu tun hat.
Warum der Trend zum Selbermachen andauert
Ob Repair-Café oder Woman’s Night, ob Einkochen, Nähen oder Häkeln: Die Begeisterung dafür, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen, ist allgegenwärtig – und scheint immer weiter zu erstarken. Manchen mag dies wie eine weltabgewandte Retro-Sehnsucht erscheinen, wie ein Symptom des “Zeitalters der Nostalgie”, das Zygmunt Bauman, einer der angesehensten Philosophen und Soziologen der Nachkriegszeit, in seinem Werk “Retrotopia” diagnostiziert: Nicht mehr Utopia locke die Menschen heute, so Bauman, eine künftige, fortschrittliche Existenz voller neuer Möglichkeiten – sondern die gute alte Welt, in der es mehr Qualität gibt als Quantität, mehr sorgfältige Handarbeit als schnelle Fertigung.

Eine Umfrage offenbart aber noch eine weitere Motivation der Selbermacher: Fast die Hälfte aller Handarbeiter werkeln deshalb so gern, weil sie Freunde, Partner, Kinder beschenken möchten – und zwar mit etwas, das originell ist und einzigartig. Wer heute also etwas selber macht, der will nicht nur sich selbst spüren, seine eigenen Hände, seine Kreativität. Oft sucht derjenige auch einen Weg, das Band zu anderen zu stärken. Aus do it yourself wird so do it for others.
Auch Benjamin Wroblewski, der Imker, genießt es, ab und zu ein Glas Honig zu verschenken – und seine drei Kinder an seiner Arbeit mit den Bienen teilhaben zu lassen. Sogar in den kalten Monaten, wenn die Bienen in Winterruhe ausharren, gehören die Tiere zum Alltag der Familie: Er streicht und bessert die Beuten aus, manchmal sind Notfütterungen erforderlich, oder er nutzt die Zeit für Fortbildungen. Und aus dem Wachs der Insekten zieht die Familie an kalten Wintertagen eigene Kerzen. “Dank der Bienen”, sagt Wroblewski, “finden wir das ganze Jahr über Möglichkeiten, der Hektik des Alltags zu entfliehen”.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 105.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 105.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: