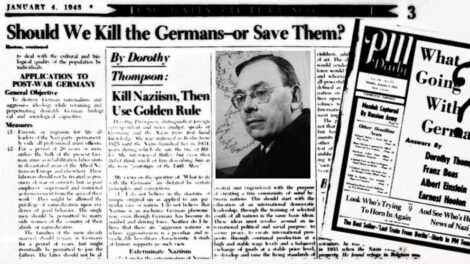Pünktlich zu den Friedensverhandlungen kocht eine alte Geschichte wieder hoch: Trump soll Ende der Achtziger in eine Falle des KGB getappt sein – und bis heute im Interesse Moskaus handeln. Doch die Story dürfte einem ganz anderen Sumpf entsprungen sein.
Wir schreiben das Jahr 1987. Die Welt steckt mitten im Kalten Krieg, als der ehrgeizige New Yorker Immobilienunternehmer Donald Trump in ein Flugzeug nach Moskau steigt. Offiziell will er mit den Sowjets einen Hotel-Deal abschließen, doch hinter den Kulissen lauert der KGB – bereit, den Amerikaner in ein Netz aus Intrigen zu locken. Und tatsächlich: Die Falle schnappt zu! Das behauptet zumindest der US-Journalist Craig Unger in seinem 2021 erschienenen Buch American Kompromat, das momentan wieder durch die Medien geistert. «Die Russen haben Trump über Jahrzehnte hinweg umgarnt», schreibt Unger, für den der heutige US-Präsident ein Agent des Kremls ist, der gezielt aufgebaut wurde, um in Washington die Macht zu ergreifen.
Seine These: Der sowjetische Geheimdienst habe Trump schon früh als «perfektes Ziel» auserkoren. Warum? Weil er ein Mann mit Schwächen war: unstillbarer Hunger nach Ruhm, Reichtum und Macht. «Sie haben ihn wie eine Fliege ins Netz gelockt», so der Autor. Besonders pikant: Schon Ende der Achtziger soll Trump von politischer Macht geträumt haben – ein Ehrgeiz, den die Sowjets gnadenlos ausgenutzt hätten. War sein Aufstieg ins Weiße Haus am Ende Teil eines russischen Masterplans?
Kompromittierendes Material
Genau das legt Unger in American Kompromat nahe. Und er hat einen Kronzeugen: Juri Schwez, ein ExKGB-Agent, der in den 1980er Jahren in Washington spionierte und später die US-Staatsbürgerschaft erhielt. 2021 erzählte er dem britischen Guardian, dass Trump seit den 1970er Jahren als potenzielles «Asset» auf dem Radar des sowjetischen Geheimdienstes gewesen und 1987 gezielt umgarnt
worden sei. Schwez: «Für den KGB war es eine Charme-Offensive. Sie taten, als seien sie extrem beeindruckt von seiner Persönlichkeit. (…) Man hatte das Gefühl, dass er intellektuell und psychologisch extrem verwundbar war; er war sehr empfänglich für Schmeicheleien.» In American Kompromat geht er noch weiter. Unger zitiert den Ex-Geheimdienstler mit folgender Aussage über Trump: «Der Kerl ist kein kompliziertes Rätsel – seine wichtigsten Eigenschaften sind ein geringer Intellekt gepaart mit übertriebenem Eigenlob. Diese Mischung macht ihn zum Traum eines jeden erfahrenen Rekrutierers.» Schwez sagt, dass der KGB auf Trump aufmerksam geworden sei, als er mit seiner damaligen Frau Ivana, einem vormaligen tschechischen Model, erste Kontakte nach Osteuropa knüpfte. Der große Coup soll den Russen bei Trumps erster MoskauReise gelungen sein. «Sie haben ihn mit offenen Armen empfangen», so Schwez. «Jede Begegnung war geplant, jeder Handschlag kalkuliert. Der KGB wusste: Dieser Mann ist formbar.»
Unger baut auf den Angaben des ehemaligen Spions eine Story auf, die wie aus einem James-Bond-Film klingt: Der KGB habe Trump demnach nicht nur umworben, sondern auch kompromittierendes Material gesammelt – sogenanntes Kompromat. Ob es Sex, Geld oder schmutzige Deals gewesen sein sollen, bleibt unklar. Aber eines steht für den US-Autor fest: Die Russen hätten ihn in der Hand (Original: «They owned him»). Kronzeuge Schwez liefert dafür keine harten Beweise – keine Akten, keine Dokumente, keine Tonbänder. Doch seine Schilderungen lassen Raum für wilde Spekulationen.
Sexpartys am Roten Platz
Tatsächlich landete Trump am 4. Juli 1987, dem amerikanischen Nationalfeiertag, auf dem Flughafen Scheremetjewo in Moskau. Der Immobilien-Tycoon reiste damals auf Einladung des sowjetischen Botschafters Juri Dubinin ins «Reich des Bösen» (Ronald Reagan), um mit dem Klassenfeind ein Joint Venture für den Bau von Luxushotels zu vereinbaren. Das klappte zwar letztlich nicht, sei aber ohnehin nur ein Vorwand gewesen. «Seine Einladung nach Moskau 1987 war als erste Erkundung für ein Hotel getarnt, aber laut Schwez wurde sie von einem hochrangigen KGB-General, Ivan Gromakow, initiiert. Solche Reisen wurden üblicherweise für ”tiefe Entwicklung” arrangiert – Rekrutierung oder Treffen mit KGB-Kontakten», schreibt Unger in seinem Buch. Trump checkte im Hotel National ein – ein Nobelhaus direkt am Roten Platz, das vom KGB kontrolliert wurde. Verwanzt bis unters Dach, Kameras in jeder Ecke – das behauptete der russische Überläufer Viktor Suworow nach Luke Hardings bereits 2017 erschienenem Buch Verrat. «Typen mit Zukunft lud man gerne ein», wird Suworow darin zitiert. «Partys mit hübschen Mädchen, Saunabesuche – alles, um sie in die Falle zu locken.» Unger greift das auf und fragt: Hat der KGB hier den Grundstein für Trumps Abhängigkeit gelegt? Gab es Fotos oder Filme, die Trump später erpressbar machten? Die Story klingt heiß – aber auch hier fehlen Beweise, und die Indizien bleiben dünn. Der größte Haken: Trump hatte Gattin Ivana mit nach Moskau genommen. Dass er damals auf «Partys mit hübschen Mädchen» in eine Honigfalle getappt sein könnte, ist unwahrscheinlich.
Kürzlich ist nun ein weiterer angeblicher Zeuge aufgetaucht, der den Gerüchten neue Nahrung gibt: Alnur Mussajew, Ex-Chef des kasachischen Geheimdienstes KNB und einst KGB-Offizier. In einem Facebook-Post vom 20. Februar 2025 schreibt er, Trump sei 1987 vom KGB unter dem Decknamen «Krasnow» rekrutiert worden. Mussajew wörtlich: «Es war das Jahr, in dem unsere Abteilung einen 40-jährigen Geschäftsmann aus den USA rekrutiert hat – Donald Trump, unter dem Pseudonym Krasnow. (…) Donald Trump ist am Haken des FSB und schluckt den Köder immer tiefer. (…) Ich habe keinen Zweifel daran, dass Russland den Präsidenten der Vereinigten Staaten kompromittiert hat und dass der Kreml Trump viele Jahre lang zum Präsidenten der wichtigsten Weltmacht befördert hat.» Beweise? Auch hier: Fehlanzeige! Kritiker werfen dem Ex-Agenten vor, Aufmerksamkeit heischen zu wollen – und einen Rachefeldzug gegen den US-Präsidenten wegen dessen Ukraine-Krieg zu führen. Mussajews Aussagen kommen Gegnern von Trumps Friedenskurs jedenfalls wie gerufen – und genau das dürfte auch ihr Zweck sein.
Alter Wein in neuen Schläuchen
Die vermeintlichen Enthüllungen riechen nämlich regelrecht nach einer Aktion des Tiefen Staates. Mit ähnlichen Vorwürfen hatte der US-Präsident bereits in seiner ersten Amtszeit zu kämpfen. Stichwort: Russland-Affäre. Damals hieß es, Trump habe mit dem Kreml kollaboriert, um gegen Hillary Clinton zu gewinnen, Moskau habe die Wahl beeinflusst. Der Report von Sonderermittler Robert Mueller, veröffentlicht im April 2019, sollte Klarheit bringen. Ergebnis: Keine Beweise für eine Verschwörung! Mueller stellte fest: «Die Untersuchung hat nicht ergeben, dass die Trump-Kampagne oder Personen, die mit ihr in Verbindung stehen, mit der russischen Regierung konspiriert oder sich koordiniert haben.» Doch der Schaden war angerichtet – und lässt Trump bis heute nicht mehr los.
Der republikanische Senator Rand Paul roch schon damals den Braten. Am 15. März 2019 twitterte er: «Die Russland-Untersuchung war eine Hexenjagd, orchestriert von Leuten im Deep State, die Trump nie akzeptiert haben.» Ähnlich äußerte sich Trumps Ex-Berater Steve Bannon gegenüber dem britischen Spectator (20. Juli 2019): «Das war ein politischer Anschlag, gesteuert von CIA und FBI, um einen gewählten Präsidenten zu stürzen.» Diese Vermutung liegt auch deshalb nah, weil einige der Vorwürfe auf Geheimdienstangaben basierten, insbesondere auf dem sogenannten Steele-Dossier, das die Russland-Affäre erst ins Rollen brachte. Dieses Dokument, das im Januar 2017 vom Nachrichtenportal BuzzFeed News veröffentlicht wurde, enthielt ungeprüfte und unbestätigte Informationen über angebliche Verbindungen zwischen Trump und Moskau, die Christopher Steele, ein ehemaliger Offizier des britischen Geheimdienstes MI6, zusammengetragen hatte. In seinem Dossier behauptete er, Russland verfüge über Kompromat, etwa von einer MoskauReise Trumps 2013, und unterstellte, dass es laufende Kontakte zwischen Mitarbeitern seiner Wahlkampagne und russischen Akteuren gegeben habe. Die US-Geheimdienste FBI, CIA und NSA griffen das Dossier begierig auf und reicherten es im Rahmen eigener Ermittlungen an. Am 6. Januar 2017 veröffentlichten sie schließlich einen gemeinsamen Bericht, der Steeles Angaben scheinbar bestätigte und behauptete, dass Russland versucht hätte, die Wahl 2016 zugunsten Trumps zu beeinflussen – etwa durch Hacking von Online-Konten der Demokratischen Partei und Desinformationskampagnen.
Nun also ein neuer Aufguss – genau zu dem Zeitpunkt, in dem die Verhandlungen für einen Frieden in der Ukraine konkrete Formen annehmen! «Das stinkt nach einer koordinierten Attacke», so der konservative Kommentator Tucker Carlson am 10. März 2025 in seiner Show auf X. «Die Eliten wollen keinen Frieden – sie wollen Trump bluten sehen!» Carlson verweist auf die Russland-Affäre: «Damals haben sie ihn mit Dreck beworfen, ohne Beweise. Heute machen sie’s wieder!» Auch der Historiker Victor Davis Hanson sieht Parallelen. In einem Artikel für National Review (5. März 2025) schreibt er: «Die Wiederbelebung der KGB-Story passt perfekt zu den Interessen jener, die Trumps Außenpolitik sabotieren wollen. Es ist ein Echo der Mueller-Zeit – nur dreister.» Das trifft die Sache ziemlich gut.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: