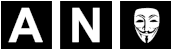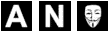Fünf Monate nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs klingen am Heiligen Abend plötzlich Weihnachtslieder über Flanderns Schlachtfelder. Erbitterte Kriegsgegner aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich werfen am 24. Dezember 1914 ihre Waffen weg, klettern aus den Schützengräben und feiern gemeinsam Weihnachten. Es beginnen die seltsamsten Stunden dieses gewaltigen Konflikts.
Regen in Flandern. Unaufhörlich, Tag um Tag. Er prasselt auf die überschwemmten Wiesen an der Kanalküste – hier, wo die belgische Armee vor zwei Monaten die Fluttore der Deiche geöffnet hat, um die andrängenden deutschen Verbände aufzuhalten, irgendwie. Er hüllt die Mauern der alten Stadt Ypern in graue Schleier und plätschert in den Festungsgraben. Trommelt auf die aufgerissenen Straßen, spült den Staub von Trümmerhaufen, rinnt durch das zerschossene Dach der einst prächtigen gotischen Tuchhalle und zieht Schlieren über die rußigen Wände ausgebrannter Häuser.
Es ist der 20. Dezember 1914, und in den Hügeln um Ypern sowie im weiter südlich gelegenen Tal des Flusses Lys lässt der Regen die Feldgräben überlaufen, tropft von den Zweigen der Hecken, füllt Granattrichter bis zum Rand und verwandelt die Äcker in zähen Morast. Er strömt in die Ruinen zerstörter, verlassener Dörfer, durchnässt das Fell umherirrender Kühe, fällt auf aufgedunsene Pferdekadaver und durchweicht die Uniformen der toten Soldaten, die unbeerdigt auf den Schlachtfeldern verwesen.
Wochenlang ist hier erbittert gekämpft worden, haben die Deutschen mit aller Macht versucht, die feindlichen Stellungen zu durchbrechen und doch noch bis nach Paris vorzustoßen, wie es ihr Plan war. Wochenlang haben sich Franzosen, Belgier und Briten den Angreifern entgegengestemmt. Nun hat sich der Krieg in Flandern festgefressen: Nördlich von Ypern beginnen die Schützengräben, die sich in zwei Linien 720 Kilometer weit bis zur Schweizer Grenze winden. Die Westfront ist erstarrt.
Die Kämpfer hocken in ihren Stellungen wie Gefangene in einem Verließ
Zu Weihnachten würden sie siegreich wieder zu Hause sein, hatten die Soldaten geglaubt, auf beiden Seiten. Stattdessen sitzen sie nun im Schlamm der Schützengräben. Das Wasser flutet von oben herein und quillt von unten aus dem Boden, die vollgesogene Lehmerde ist weich wie Brei. Grabenwände brechen ein, die Schlaflöcher sind feucht, kniehoch stehen die Männer im Matsch.
Ihre Füße in den nassen Stiefeln sind geschwollen und taub, die Kleider werden niemals trocken. In der braungelben Brühe schwimmen Ratten, fettgefressen an den Toten im Niemandsland, die auf einer nächtlichen Patrouille oder bei einem der vielen vergeblichen Sturmangriffe gefallen sind. Die Soldaten sehen die Leichen nicht, denn wer den Kopf über die Grabenkante hebt, ist ein gutes Ziel für die lauernden Scharfschützen. Aber sie riechen die Kadaver.
Wie Gefangene in einem Verlies hocken die Kämpfer in ihren Stellungen, umgeben vom Gestank der verwesenden Toten und ihrer eigenen Exkremente. Ihren Feinden sind sie dabei oft so nah, dass sie sich über das Niemandsland hinweg Schimpfworte zurufen können.
Dann plötzlich, am 24. Dezember, endet der Regen. Die Wolken zerreißen. Abends ist es bitterkalt – und still. Am Himmel glitzern die Sterne. Im Graben der London Rifle Brigade, die ein Wäldchen südlich von Ypern verteidigt, steht Graham Williams Wache. Noch als alter Mann wird er sich daran erinnern. Sein schlammverschmierter Mantel ist bretthart gefroren. Er denkt an Weihnachten zu Hause. Die Girlanden aus Stechpalmen, mit denen seine Familie die Räume schmückt. Den Rumpunsch, den sein Vater zubereitet.

Verschanzt hinter einer Sandsackbarriere, starrt Williams in das öde, stille Land. Da flackern unversehens kleine Lichter an der Brüstung des deutschen Grabens auf. Hell leuchten sie in der klaren Luft: Kerzen, die an Weihnachtsbäumchen brennen! Dann wehen plötzlich Töne herüber. Eine Melodie ist zu erkennen: “Stille Nacht, heilige Nacht”. Ein Chor aus tiefen Männerstimmen.
Neugierig kriechen einige Kameraden von Williams aus ihren Schlaflöchern in den Seitenwänden der Schützengräben und setzen, als drüben der Gesang verklungen ist, selber zu ein paar Strophen an: zu “The First Nowell”, einem traditionellen englischen Weihnachtslied. Dann singen wieder die Deutschen: “O Tannenbaum”. Und so geht es weiter, Lied um Lied. Als die Briten “O Come All Ye Faithful” anstimmen, fallen die Deutschen mit der lateinischen Version ein: “Adeste Fideles”. Am Morgen hat ein deutscher Scharfschütze noch ein Mitglied der London Rifles erschossen – nun singen alle gemeinsam.
Wenige Kilometer entfernt sind andere Soldaten noch mutiger. Als die Deutschen eine “Frohe Weihnacht” wünschen und verkünden, an diesem Abend nicht schießen zu wollen, rufen die Gegner zurück: “Wir auch nicht.”
Dann stellen die Briten Lichter auf, Gewehre mit aufgepflanztem Bajonett dienen als Kerzenständer. Bald darauf klettern einige Soldaten sogar aus dem Graben. Und wagen sich ins Niemandsland vor, den strahlenden deutschen Weihnachtsbäumen entgegen. Etwa zur gleichen Zeit machen sich auch Deutsche auf den Weg – und bringen den Briten Geschenke mit: Süßigkeiten, Wein und Zigaretten. “Es schien fast”, schreibt einer von ihnen später in einem Brief, “als wäre der Krieg vorbei.” So beginnen an Weihnachten des Jahres 1914 die wohl seltsamsten Stunden des Ersten Weltkriegs. Insgesamt werden zum Christfest etwa 100 000 Kämpfer ihre Waffen niederlegen und sich vorübergehend mit ihren Feinden verbrüdern.
Niemand kann heute mehr sagen, wo genau die spontane Waffenruhe ihren Anfang genommen hat. Zu spärlich sind die Quellen – nur einige wenige Briefe, Tagebücher und Zeitungsberichte. Vermutlich solidarisieren sich mehrere Einheiten gleichzeitig und unabhängig voneinander. Auch lässt sich nicht mehr rekonstruieren, wie sich dieser spontane Waffenstillstand von einem Abschnitt zum nächsten fortpflanzt. Nur so viel ist klar: Das Zentrum der Verbrüderungen ist jener knapp 45 Kilometer lange Abschnitt in Flandern, an dem sich Briten und Deutsche gegenüberliegen.
Die Generäle sorgen sich um den Kampfeswillen ihrer Männer
So unwirklich ist das Ereignis, dass manche Soldaten, die es nicht miterleben, es später als Latrinengerücht abtun werden. Doch es gibt ihn tatsächlich: den kleinen Frieden mitten im Krieg. Dabei haben die Mächtigen auf beiden Seiten zuvor durchaus versucht, genau so etwas zu verhindern.
Schon seit Beginn der Adventszeit sorgen sich die Generäle um den Kampfeswillen ihrer Männer. Sie fürchten, deren Angriffsgeist könnte leiden, wenn sie sich mit dem nur wenige Dutzend Meter entfernten Feind arrangieren – vor allem während des langen Wartens. Denn es fällt viel schwerer, auf einen Gegner zu zielen, den man gut kennt. Immer wieder haben Heere, die sich über längere Zeit nahe waren, spontane Waffenruhen verabredet – etwa im Krimkrieg oder während der napoleonischen Feldzüge in Spanien.
Wenn Soldaten untätig bleiben, so lässt am 5. Dezember Sir Horace Smith-Dorrien, der Kommandeur des 2. Britischen Armeekorps, in einer Anweisung an seine Offiziere verkünden, “besteht die größte Gefahr für die Moral der Truppen”. Die Soldaten könnten “in eine Lethargie versinken, aus der man sie nur schwer wecken kann, wenn der Moment für große Opfer wiederkommt”.
Der erfahrene Kommandeur weiß, dass Soldaten bisweilen Kontakt miteinander aufnehmen – um unter anderem kleine Erleichterungen zu vereinbaren, etwa Kampfpausen während der Mahlzeiten. Und in seinem Tagebuch notiert Smith-Dorrien in diesen Tagen beunruhigende Gerüchte von der Front: “Sie rufen sich gegenseitig zu und bieten sich Dinge zum Tausch an.” Daher schärft er seinen Offizieren noch einmal ein: “Freundlicher Umgang mit dem Feind, inoffizielle Waffenruhen, so verführerisch und gelegentlich amüsant sie auch sein mögen, sind absolut verboten.” Derartige “Fraternisierungen” sind ein Fall für das Kriegsgericht.
Doch am 7. Dezember richtet Papst Benedikt XV. einen Appell an die Kriegsparteien: Sie sollten wenigstens während jener Tage, an denen “die Christenheit das Fest der Erlösung der Welt feiert”, die Kanonen schweigen lassen. Alle Regierungen lehnen ab: ein Waffenstillstand – unmöglich. Stattdessen hetzt General Horace Smith-Dorrien seine Soldaten in sinnlose Sturmangriffe. Am 18. Dezember zerschellt ein Vorstoß der Briten unter großen Verlusten nahe Ypern an den deutschen Linien.

Beide Seiten setzen aber nicht allein auf Zwang, um die Kampfmoral ihrer Armeen zu sichern, sondern auch auf Großzügigkeit. Mit Geschenken versuchen sie die Soldaten zufriedenzustimmen – und stoppen sogar für einen Tag den gesamten militärischen Nachschub, damit die Weihnachtspakete pünktlich an die Front gelangen.
Jeder britische Frontkämpfer erhält Tabak, Zigaretten und eine Pfeife in einer kleinen Messingdose, die ein Bild der 17-jährigen Prinzessin Mary ziert. Auf einer Weihnachtskarte wendet sich König George V. persönlich an seine uniformierten Untertanen: “Möge Gott Sie schützen und sicher nach Hause bringen.” Selbst an die Nichtraucher ist gedacht: In ihren Dosen sind Süßigkeiten. Und auch von ihren Angehörigen bekommen viele Männer Leckereien, etwa einen Plumpudding, die schwer-süße britische Weihnachtsspezialität.
Der deutsche Kaiser hatte seinen Soldaten im Sommer versprochen, dass sie wieder daheim wären, “ehe noch das Laub von den Bäumen fällt”. Nun sorgt er zumindest dafür, dass Abertausende Pakete mit warmen Socken, Würsten und Schokolade ins Feld geliefert werden. “Liebesgaben” nennt die Propaganda des Kaiserreichs diese Post aus der Heimat. Der Kronprinz schickt Meerschaumpfeifen an die Front, auf denen sein Porträt prangt. Die wichtigste Sendung jedoch erreicht die deutschen Truppen kurz vor Heiligabend: Tausende etwa 80 Zentimeter hohe Fichten, mit Kerzen geschmückt und mit einem Holzkreuz als Fuß.
Weil aber in den engen und verwinkelten Grabenanlagen kein Platz ist für die Weihnachtsdekoration, stellen viele der deutschen Soldaten die Christbäume kurzerhand auf die schützende Brüstung ihrer Gräben und zünden die Kerzen an.
Als die Briten die leuchtenden Bäume zum ersten Mal erblicken, glauben viele anfangs an einen Trick. Wollen die Deutschen sie täuschen? Hat das Oberkommando nicht vor einem Überraschungsangriff genau an den Festtagen gewarnt? Und wäre solche Tücke den verhassten “Hunnen” nicht zuzutrauen? Tatsächlich feuern einige Briten auf die Weihnachtsbäume, doch am Abend des 24. Dezember siegt schließlich doch die Neugier über das Misstrauen.
“Nie zuvor war ich mir des Wahnsinns des Krieges so bewusst.”
Gemeinsam singen und musizieren deutsche und britische Soldaten die Nacht hindurch. Nicht immer wagen sie sich dabei ins Niemandsland vor; oft setzen sie sich auch nur auf die Brüstung ihrer Stellungen.
Deutsche Kapellen, wie sie zu vielen Regimentern gehören, spielen Weihnachtslieder. Einige Briten ziehen ihre Mundharmonika hervor. Andere fordern Volksweisen oder ein Stück von Robert Schumann und applaudieren, als die Deutschen ihrem Wunsch nachkommen. An einem anderen Abschnitt der Front, den die Franzosen verteidigen, erklimmt ein deutscher Violinist gar den Rand des Schutzgrabens und spielt ungestört das “Largo” von Georg Friedrich Händel.
“Nie zuvor”, so schreibt ein Soldat der bayerischen Armee später über diese Stunden, “war ich mir des Wahnsinns des Krieges so bewusst.” Und ein anderer erinnert sich: “Es war eine wundervolle Nacht.” Wie aber ist dieses Ereignis zu erklären: dass Soldaten sich plötzlich mit jenen Männern verbrüdern, die sie zuvor wochenlang versucht haben zu töten?
Eines ist gewiss: Ohne den Wetterumschwung, ohne den plötzlich einsetzenden Frost hätte es diesen “Weihnachtsfrieden” nicht gegeben. Erst die Kälte verschafft den Soldaten jene ersehnte Atempause, indem sie das Elend in den überfluteten Gräben lindert. Vor allem jedoch macht der Frost das von den Kämpfen verwüstete Niemandsland wieder passierbar.
Zudem eint die tiefe Sehnsucht nach Ruhe die Truppen beider Seiten. In Flandern haben Deutsche und Briten einander in den Wochen zuvor bis zur völligen Erschöpfung bekämpft, wurden Tausende Soldaten von ihren Offizieren in sinnlose Sturmangriffe gejagt, ohne jede Deckung. Die Verluste waren schrecklich. Gerade die einfachen Soldaten, die am meisten gelitten haben, hoffen endlich auf eine Phase der Entspannung.
Vor allem Belgiern und Franzosen fällt es schwer, sich mit den Deutschen zu versöhnen
Und Weihnachten ist der Anlass, auf den sie gewartet haben. “Wir alle spürten, dass auch die boches Ruhe wollten”, schreibt der britische Soldat Bruce Bairnsfather (und benennt die Deutschen bei ihrem französischen Spitznamen). “Ein unbestimmtes Gefühl verbreitete sich über dem gefrorenen Sumpf zwischen den Linien, das einem sagte: Für uns alle ist Heiligabend – das haben wir gemeinsam.”
Doch der entscheidende Grund für die Fraternisierungen, vermuten Historiker, sind nicht Erschöpfung und Weihnachtsstimmung, sondern die hohen Verluste in den ersten Kriegsmonaten. Jene fanatischen jungen Deutschen, die im August 1914 den Ausbruch des Krieges bejubelt haben, hätten sich vermutlich nicht mit ihren Feinden versöhnt – aber viele von ihnen sind an Weihnachten schon nicht mehr am Leben. Ihre Plätze in den Gräben haben meist ältere Reservisten eingenommen; Männer mit Familien und Lebenserfahrung, die sich nicht so leicht von der Propaganda beeinflussen lassen. Häufig sind sie es, die die Initiative ergreifen und auf die Feinde zugehen.
Allerdings stoßen längst nicht alle Avancen auf freundliche Reaktionen: So manches Friedensangebot bleibt ungehört oder wird mit Maschinengewehrfeuer beantwortet. Vor allem Belgiern und Franzosen fällt es schwer, sich vorübergehend mit jenen Männern zu versöhnen, die in ihre Heimatländer einmarschiert sind. Auch an der britischen Kampflinie sterben in der Christnacht rund 100 Soldaten.
Noch sind die Frontabschnitte, an denen auf beiden Seiten für eine Weile der Krieg vergessen wird, wenig mehr als vereinzelte Inseln des Friedens. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht die Sonne über einer weiß glitzernden Landschaft auf. Raureif überzieht die Stacheldrahtverhaue, dünner Frühnebel schwebt über dem Boden. Dass sie in der Nacht mit ihren Feinden Weihnachtslieder gesungen haben, erscheint manchen Soldaten nun, da sie aus ihren Wolldecken kriechen, zunächst wie ein wirrer Traum.

In den Gräben am Ploegsteert-Wald, wo sich Graham Williams wenige Stunden zuvor über die deutschen Christbäume gewundert hat, recken sächsische Infanteristen ihre Köpfe über die Brüstung. Auf der anderen Seite lugen die Briten über die Grabenkante. Wieder fällt kein einziger Schuss. Daraufhin klettern überall Soldaten aus ihren Stellungen.
Wie diese Frontkämpfer werden sich am 25. Dezember 1914 weitaus mehr als die Hälfte aller Soldaten in Flandern ins Niemandsland wagen. Der nächtliche Vorstoß einiger Hasardeure wird zur Massenbewegung.
In der kaum 100 Meter breiten Todeszone zwischen den Linien drängen sich schon bald Menschen, mischen sich die erdfarbenen Uniformen der Briten mit dem Feldgrau der Deutschen. Als Bruce Bairnsfather auf allen vieren aus seinem Schlafloch kriecht, bemerkt er, dass Kameraden schon aufgebrochen sind – und nun mit den Soldaten des Kaisers in einem primitiven Englisch plaudern.
Einige Offiziere, Briten ebenso wie Deutsche, versuchen noch, ihre Männer aufzuhalten. Doch meistens kommen sie zu spät. Selbst jene Militärs, die für ihre Härte berüchtigt sind, müssen einsehen, dass ihre Soldaten sie überrumpelt haben. Der Weihnachtsfrieden – das ist auch ein Sieg der Frontkämpfer über ihre Anführer in der Etappe. Nur wenige Befehlshabende melden die Waffenruhe an die abgelegenen Hauptquartiere im Hinterland. Wer will schon das eigene Versagen offenbaren?
Vielleicht aber sehnen sich auch viele von ihnen nach einer Kampfpause. Manche Offiziere schauen weg, lassen ihre Männer gewähren oder treffen sich sogar mit den feindlichen Truppenführern. Andere nutzen die günstige Gelegenheit und entsenden Kundschafter, um die gegnerischen Stellungen auszuspionieren, oder lassen zumindest ihre eigenen Gräben ausbessern.
Viele Soldaten beerdigen im Weihnachtsfrieden ihre Toten
“Es ist schwierig zu sehen, was wir hätten anders machen können”, rechtfertigt sich später ein britischer Truppenführer. Immerhin “bekamen unsere Offiziere einige exzellente Nahansichten der deutschen Gräben, und wir haben dementsprechend profitiert”.
Viele Soldaten aber tun, was ihnen weder Feinde noch Generäle vorwerfen können: Sie beerdigen ihre Toten. Denn die Sonne an diesem Weihnachtstag scheint nicht nur auf ein winterliches Idyll – sondern zugleich auch auf ein Panorama des Schreckens: Unter Raureif und einer dünnen Schneedecke liegen Hunderte verrenkte, zerfetzte und halbverweste Körper – die Leichen gefallener Kämpfer. Manche von ihnen sind schon vor Wochen gestorben, als sich die Armeen nach der ersten großen Flandernschlacht an der Front eingruben.
Auch das Niemandsland beim Dorf Fleurbaix, zwischen den Stellungen der schottischen Gordon Highlanders und den Gräben des Westfälischen Infanterieregiments Nr. 15, ist voll von gefallenen Soldaten. Hier, etwa 20 Kilometer südlich von Ypern, haben sich beide Einheiten vor einer Woche erbittert bekämpft.
Nun geht der Armeegeistliche der Schotten, ein 49-jähriger Kaplan, auf die Deutschen zu. In der Mitte des Todesstreifens, an einem von Weiden gesäumten Ackergraben, bleibt er mit erhobenen Händen stehen und bittet um ein Gespräch mit den Offizieren. Sie sind sich schnell einig: Schotten und Westfalen tragen gemeinsam die starren Leichen zusammen und übergeben den Gegnern deren tote Kameraden. Mehr als 100 sind es, vor allem schottische Gardisten, die am 18. Dezember den Angriffsbefehl befolgen mussten. “Es war herzzerreißend”, notiert ein britischer Offizier in seinem Kriegstagebuch.
Weil der Boden gefroren ist, schaufeln Schotten und Deutsche nicht für alle gefallenen Briten Ruhestätten, sondern legen viele der Toten kurzerhand in die Furche unter den Weiden. Dann versammeln sich Deutsche und Briten um das Massengrab. Als Geleitwort für die Gefallenen spricht der Kaplan den 23. Psalm auf Englisch, danach wiederholt ihn ein westfälischer Theologiestudent auf Deutsch: “Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser.” Anschließend beten alle das “Vaterunser”, Satz für Satz, in beiden Sprachen.
Die Schlachtfelder Flanderns erinnern an einen Rummelplatz
Nach der Beerdigung unterhalten sich Briten und Deutsche, als hätten sie gemeinsam ein Begräbnis alter Freunde begangen. Die Schotten spielen Dudelsack, und wie an so vielen Orten der Front beschenken die Gegner einander. Ausgerechnet die “Liebesgaben” des deutschen Kaisers an seine Soldaten enden in den Uniformtaschen der Briten – als Tauschware für das begehrte englische Büchsenfleisch.
Die Soldaten von der Insel haben es aber auch auf andere Souvenirs wie deutsche Uniformknöpfe und Gürtelschnallen abgesehen. So kauft sich ein Angehöriger der London Rifles im Niemandsland eine Pickelhaube. Der Preis: reichlich Fleisch und Marmelade.
Die Schlachtfelder Flanderns erinnern nun immer mehr an einen Rummelplatz: Männer schütteln einander die Hände und versuchen, sich mit Gesten zu verständigen. Einige Deutsche, die vor dem Krieg im Vereinigten Königreich gearbeitet haben, dienen sich den Kameraden als Dolmetscher an – und treffen in den von Granaten verwüsteten Äckern sogar alte Bekannte: Ein Engländer begegnet seinem deutschen Friseur, den er einst in London kennengelernt hat und der nun im Niemandsland Freund und Feind für ein paar Zigaretten die Haare schneidet. Und ein Sachse kommt ins Gespräch mit einem Briten, der vor dem Krieg regelmäßig mit demselben Pendlerzug wie der Deutsche in die Londoner City gefahren ist. Wie lächerlich scheint es jetzt mit einem Mal, sich gegenseitig umzubringen.
In Flandern beginnt ein skurriles Schauspiel: Blechkapellen und Männerchöre übertönen sich gegenseitig. Briten und Deutsche jagen Hasen oder streunende Schweine und grillen ihre Beute noch an Ort und Stelle. Schnapsflaschen werden herumgereicht, Soldaten zeigen ihre Familienfotos und versprechen einander, sich nach dem Krieg zu schreiben. Andere Männer plündern verlassene belgische Bauernhäuser und fahren in schrillen Verkleidungen, mit Frauenröcken und Zylindern, auf Fahrrädern herum – fast wie in den Weihnachtspantomimen, die in England so beliebt sind.
Im Ploegsteert-Wald rollen sächsische Soldaten ein Bierfass zu den britischen Linien und lassen sich dafür mit reichlich Plumpudding entlohnen. Und anderswo treffen sich die Gegner zu einem improvisierten Weihnachtsessen mit Sauerkraut und englischem Dosenfleisch.

Hier und da kommt es sogar zu kleinen Fußballmatches, kicken die Männer leere Konservenbüchsen über den von Kratern übersäten Todesstreifen. Angeblich, so erzählen es manche später, kommt es sogar zu einer Art Länderspiel. Selbst das Ergebnis ist überliefert – 3 : 2 für die Deutschen.
Und im britischen Imperial War Museum können die Besucherinnen und Besucher bis heute einen prächtigen Bierkrug bestaunen, das angebliche Geschenk des deutschen Mannschaftskapitäns. Doch einen Beweis für ein solches offizielles Spiel haben die Historiker bis heute nicht gefunden. Zur Stimmung an diesem 25. Dezember 1914 hätte eine solche Partie aber sicherlich gepasst. “Da waren diese wurstfressenden Kerle, die dieses höllische Durcheinander angerichtet hatten”, schreibt Bruce Bairnsfather. Trotzdem habe es an diesem Tag “auf keiner Seite auch nur ein Atom Hass” gegeben.
Die Propagandaparolen gelten nicht mehr. Für die Soldaten sind die Männer auf der anderen Seite des Todesstreifens plötzlich Menschen, denen sie die Fotos ihrer Kinder zeigen. Er habe einen “echten lebenden Deutschen” gesehen, meldet ein englischer Soldat nach Hause. “Wir dachten: arme Teufel, sie sitzen im selben Dreck wie wir.” Und der englische Leutnant A. P. Sinkinson notiert: “Wenn man hier ist, beginnt man zu verstehen, dass man nicht ständig hassen kann.”
Es ist ein zwiespältiges Gefühl für die Briten – und wohl noch mehr für die Franzosen, die sich an diesem Weihnachtsfest mit den Deutschen verbrüdern, denn ihr Land ist ja angegriffen worden. An der französischen Front gibt es zwar nur wenige kleine Inseln des Friedens, aber es gibt sie auch hier. An der Aisne, wo im Herbst eine große Schlacht getobt hat, essen und trinken einige Hundert Soldaten gemeinsam.
Selbst zwischen Belgiern und Deutschen kommt es zu versöhnlichen Gesten. An einem Frontabschnitt, an dem sich die Gegner dicht gegenüberstehen, tauschen sie über einen Fluss hinweg Geschenke aus, und die Deutschen geben eine Monstranz zurück, die sie aus einer belgischen Kapelle geraubt hatten.
“Gentlemen, der Oberst hat befohlen, dass das Feuer wieder beginnen soll”
Doch während die Soldaten noch feiern, treffen im gut 40 Kilometer von der Front entfernten britischen Hauptquartier die ersten Nachrichten über die Fraternisierungen ein: Angeblich seien deutsche Soldaten zu den Briten hinübergerannt und hätten dabei Weihnachtsbäume über ihre Köpfe gehalten. Die Generäle ordnen daraufhin an, solche Vorkommnisse strikt zu unterbinden, und kündigen ferner an, die Kommandeure zur Rechenschaft zu ziehen.
Am Abend erreicht die Order die britischen Stellungen: “Jegliche Fraternisierung mit dem Feind muss unverzüglich aufhören. Weitere derartige Handlungen werden hart bestraft.” Ist das schon das Ende dieses kleinen Friedens mitten im Krieg?
Der zweite Weihnachtsfeiertag beginnt mit Schnee und vereinzeltem Geschützlärm. In der Nacht sind einige der Waffenruhen beendet worden – so haben es mancherorts Unterhändler miteinander vereinbart. Meist kündigt ein vorher verabredetes Signal das Ende der kurzen Feuerpause an, etwa eine Leuchtrakete, die in den Himmel steigt. Manchmal verabschieden sich Deutsche und Briten wie Boxer, die vor dem Kampf ihre Fäuste zum Gruß berühren.
“Morgen kämpfst du für dein Land und ich für meines. Viel Glück!”, erklärt ein Soldat der London Rifles seinem Gegenüber. Anderswo singen die Deutschen zum Abschied “God save the King” (immerhin ein Vetter ihres Kaisers), und die Briten applaudieren. Der Hauptmann einer Waliser Kompanie schießt dreimal in die Luft, dann klettert er aus dem Graben, wie auch der deutsche Hauptmann auf der anderen Seite. Beide verbeugen sich, salutieren und gehen in ihre Stellungen zurück. Die Toten sind begraben, und der wichtigste Weihnachtsfeiertag ist vorüber. Viele Offiziere können sich dem Fraternisierungsverbot nicht mehr länger widersetzen.
Nun herrscht wieder Krieg – aber vielerorts schießt trotzdem niemand. Denn keiner will der Erste sein. Die Soldaten eines sächsischen Regiments weigern sich offen, dem Schießbefehl Folge zu leisten. Ihre Offiziere laufen fluchend auf und ab, während die Sachsen darauf bestehen, dass die Briten gute Kerle seien. Erst als ihre Vorgesetzten damit drohen, dann eben sie zu erschießen, fügen sie sich. Aber vorerst feuern sie nur in die Luft.
An vielen Punkten der Front aber schweigen die Gewehre ganz. Noch ist die Waffenruhe nicht vorbei. Für die Deutschen ist der 26. Dezember ein Feiertag und für die Briten der “Boxing Day” – der Tag, an dem die Hausangestellten von ihren Herrschaften eine Schachtel mit Geschenken bekommen.

Inzwischen zieht der seltsame Frieden auch Neugierige an. Ein britischer Offizier macht sich auf den Weg an die Front und begibt sich am Nachmittag des 26. Dezember ins Niemandsland, um den “Soldatenfrieden” mit eigenen Augen zu sehen. Dort winkt er den Deutschen so lange zu, bis einige zu ihm kommen. Der Brite geht mit ihnen spazieren und tauscht etwas Tabak ein, den er nicht raucht, sondern wie eine Reliquie nach Hause schickt: als Andenken an das “wahrscheinlich außergewöhnlichste Ereignis des gesamten Krieges”.
Nördlich des Ploegsteert-Waldes nähern sich britische Soldaten dem Graben des Bayerischen Reserve-Infanterieregiments Nr. 16, dessen Soldaten auf der Brüstung einen Weihnachtsbaum aufgestellt und die Kerzen angezündet haben. Zusammen mit den Bayern stehen die Briten nun im Kreis um den Baum und singen Weihnachtslieder. Ein Infanterist verachtet seine Kameraden dafür: ein österreichischer Meldegänger in bayerischen Armeediensten namens Adolf Hitler. So wird es ein Veteran zumindest später berichten.
Am frühen Abend bricht schließlich General Horace Smith-Dorrien zu einem unangekündigten Frontbesuch auf. Er will selbst sehen, was dort geschieht. Doch seine Offiziere führen ihn an jene Punkte der Kampflinie, an denen sich die Soldaten nicht verbrüdert haben oder schon wieder in die Luft feuern. Ob dies mit Absicht geschieht oder aus Zufall, kann heute niemand mehr sagen. Klar ist nur: Der General erfährt nicht viel.
Erst als er wieder im Hauptquartier ist, wird ihm ein Bericht über die Fraternisierungen vorgelegt. Zornig diktiert Smith-Dorrien ein harsches Memorandum an die Kommandeure und kündigt Konsequenzen an: “Um diesen Krieg schnell zu beenden, müssen wir den Kampfgeist aufrechterhalten. Ich rufe dazu auf, mir die Namen jener Offiziere zu nennen, die an diesen Weihnachtsversammlungen teilgenommen haben.” Der britische Oberbefehlshaber John French droht gar mit dem Kriegsgericht.
Auch Erich von Falkenhayn, der deutsche Generalstabschef, ist empört. In einem Rundbefehl stellt er klar, dass Fraternisieren Hochverrat ist.
Schlechtes Wetter bewahrt einen Rest des ungewöhnlichen Friedens
Am Ende jedoch wird niemand bestraft. Zu viele Soldaten haben teilgenommen an den Verbrüderungen. Einige Männer könnte man verurteilen, aber ganze Regimenter? Zudem verweisen etliche Offiziere darauf, dass sie die Ruhepause zur Aufklärung der feindlichen Positionen genutzt hätten.
Statt ihre Männer vor Gericht zu stellen, schicken Deutsche und Briten die beteiligten Einheiten nach und nach zurück in die Etappe. Sie sollen sich von den Strapazen der Wochen zuvor erholen – wahrscheinlich aber will die militärische Führung die Schützengräben nun mit Soldaten besetzen, die nicht mit den Feinden gefeiert haben. Sie sollen auf beiden Seiten die nächste Offensive vorbereiten.
Doch am 27. Dezember beginnt es in Flandern zu regnen. Der gefrorene Boden verwandelt sich erneut in Schlamm. So tief ist der Morast, dass manche der Soldaten darin versinken und qualvoll ersticken. Einen Sturmangriff wollen die Generäle unter diesen Umständen nicht wagen.
Deshalb schießt in den letzten Tagen des Jahres an weiten Teilen der Front höchstens die Artillerie. Die Soldaten in den Schützengräben haben genug damit zu tun, ihre Stellungen nach jedem Regenguss leerzuschaufeln. Das schlechte Wetter bewahrt einen Rest des ungewöhnlichen Friedens: Mancherorts kochen Feinde Tee füreinander und leihen sich Werkzeug. Wenn doch ein Schießbefehl kommt, werden die Gegner höflichst gewarnt: “Gentlemen, der Oberst hat befohlen, dass um Mitternacht das Maschinengewehrfeuer wieder beginnen soll, wovon Euch in Kenntnis zu setzen wir uns die Ehre geben”, teilt eine deutsche Einheit den Engländern schriftlich mit.

In der letzten Dezembernacht wünschen deutsche und britische Truppen in Flandern einander ein gutes neues Jahr. Sie singen auch nochmals gemeinsam: das schottische Volkslied “Auld Lang Syne” – “Auf die alten Zeiten”.
Kurz darauf veröffentlicht das britische Oberkommando ein knappes Statement: “Nach einer Pause wegen des stürmischen Wetters bekämpfen sich Alliierte und Deutsche wieder.” Die seltsamste Episode des Ersten Weltkriegs ist beendet, offiziell zumindest. An manchen Orten zögern die Soldaten aber noch mehrere Wochen lang, bis sie wieder aufeinander schießen.
Schon in den Dezembertagen haben erste Nachrichten über die Waffenruhe die Heimat erreicht. Britische Zeitungen drucken sogar Fotos von englischen Soldaten, die im Niemandsland mit ihren Feinden posieren. Die überraschende Verbrüderung erscheint nun vielen als das letzte Aufblitzen von Menschlichkeit in einem immer brutaleren Konflikt.
Zwar erleben die Soldaten aller beteiligten Länder noch drei weitere Kriegsweihnachten – die spontane Waffenruhe vom Dezember 1914 aber bleibt einzigartig. Es gibt noch gelegentliche Kampfpausen, und auch der Kontakt zwischen den Soldaten in den Schützengräben reißt nie ganz ab, doch werden sie sich niemals wieder in der Todeszone friedlich begegnen. Zum einen lernen die Generäle aus ihren Fehlern und verhindern Fraternisierungen durch Androhung harter Strafen. Zum anderen sinkt bei den Soldaten die Bereitschaft, sich mit Gegnern zu arrangieren – zu grausam sind die folgenden Jahre.
Im April 1915 setzen die Deutschen erstmals Chlorgas ein – ein Gift, das Lungen und Atemwege verätzt. Auch viele Soldaten des Weihnachtsfriedens erleben die Attacken. Der Sanitäter Frederick Chandler trägt noch im Dezember 1914 “keinen Hass im Herzen”.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 63.200 Euro!
Um auch 2025 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 63.200 von 125.000 Euro. In einer normalen Woche besuchen im Schnitt rund 250.000 Menschen unsere Internetseite. Würde nur ein kleiner Teil von ihnen einmalig ein paar Euro spenden, hätten wir unser Ziel innerhalb kürzester Zeit erreicht. Wir bitten Sie deshalb um Spenden in einer für Sie tragbaren Höhe. Nicht als Anerkennung für erbrachte Leistungen. Ihre Spende ist eine Investition in die Zukunft. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für unsere Arbeit und unterstützen Sie ehrlichen Qualitätsjournalismus jetzt mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: