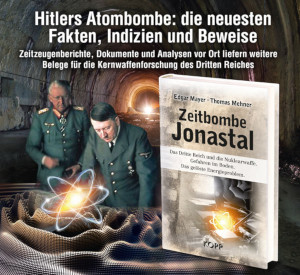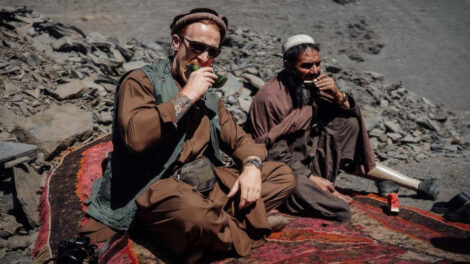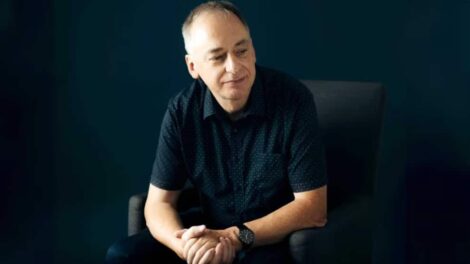Gleich mehrere Forscher-Gruppen dürften das deutsche Atomwaffenprogramm erfolgreich abgeschlossen haben – wie selbst alliierte Militärs einräumten. Unterirdische Anlagen existierten nicht nur in Thüringen, sondern auch in den Alpen.
von Dennis Krüger
Geht es nach der etablierten Zeitgeschichtsforschung, hätten weder Engländer noch Amerikaner 1944/45 einen Nuklearangriff fürchten müssen, weil in Deutschland niemals Atombomben hergestellt worden seien. Das steht allerdings im Widerspruch zu Aussagen hochrangiger NS-Funktionäre und Militärs, die intern, also nicht zu propagandistischen Zwecken, getätigt wurden. So sprach ein vertraulicher Bericht des von Ernst Kaltenbrunner geleiteten Sicherheitsdienstes bereits im Juli 1943 von Gerüchten über eine «neuartige Bombe»: «Zwölf derartige Bomben, die auf dem Prinzip der Atomzertrümmerung konstruiert seien, würden genügen, eine Millionenstadt zu vernichten.»
Der große Durchbruch
Bereits ein Jahr zuvor, Ende April 1942, hatte Generaloberst Erich Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres, davon gesprochen, Kontakt zu einem Kreis von Wissenschaftlern zu unterhalten, «die einer Waffe auf der Spur seien, die ganze Städte vernichten könne». Noch konkreter erscheint eine, freilich umstrittene, Äußerung Rüstungsminister Albert Speer, der im Januar 1945 von einem Atomexplosivstoff so groß wie eine Streichholzschachtel gesprochen haben soll, der imstande sei, «ganz New York zu zerstören».
«Ein oder zwei Schüsse, und Städte wie New York oder London werden vom Erdboden verschwinden.» Himmler
Ähnlich äußerte sich auch Reichsführer-SS Heinrich Himmler, der gegenüber seinem Leibarzt Felix Kersten eine «letzte Wunderwaffe» erwähnte, die noch nicht zum Einsatz gelangt sei: «Ein oder zwei Schüsse, und Städte wie New York oder London werden vom Erdboden verschwinden.» Und schließlich bekräftigte Hitler selbst seit 1944 immer wieder in engstem Kreis seine Prophezeiung gegenüber Fliegerass Hans-Ulrich, bald «fliegende Raketen» einzusetzen, die mit «keinem normalen Sprengstoff» bestückt seien, sondern mit «etwas anderem, so gewaltigem, dass spätestens damit die Kriegsentscheidung fallen» werde. Die Entwicklung dafür sei «schon weit fortgeschritten» und «mit der endgültigen Fertigstellung bald zu rechnen». Gegenüber dem Oberstabsarzt Dr. Giesing wurde Hitler nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 noch deutlicher: «In allerkürzester Zeit werde ich meine Siegeswaffen einsetzen, und dann wird der Krieg ein glorreiches Ende nehmen. Das Problem der Atomzertrümmerung ist seit langem gelöst, und es ist soweit ausgearbeitet, dass wir diese Energie für Rüstungszwecke benutzen können.»
War dies alles nur Wunschdenken verblendeter Fanatiker, die sich angesichts der drohenden Niederlage vollkommen von der Realität verabschiedet hatten? Ein Blick auf den Verlauf der Atomforschung bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs spricht eine andere Sprache.
Uran-Brennpunkt Südharz
Tatsache ist, dass das Heereswaffenamt (HWA) schon kurz nach Kriegsausbruch das waffentechnische Potenzial der 1939 von Otto Hahn in Zusammenarbeit mit Fritz Strassmann und Lise Meitner entdeckten Kernspaltung erkannte. Atomexperte Kurt Diebner wurde zum geschäftsführenden Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik (KWI) ernannt und ihm damit die damals führenden Kernforscher unterstellt. Im selben Jahr konnte der Nobelpreisträger und Mitbegründer der Quantenmechanik, der Leipziger Ordinarius für theoretische Physik Werner Heisenberg, als Mitarbeiter gewonnen werden. Da mit diesem sowie Carl Friedrich von Weizsäcker und Karl Wirtz die führenden theoretischen Atomphysiker im KWI versammelt waren, beschränkte sich der spätere Blick der Historiker weitgehend auf diese Gruppe. Tatsächlich gelang es diesen Wissenschaftlern nicht, einen Kernreaktor zum Laufen zu bringen oder gar eine Atombombe herzustellen.
Heisenbergs Rolle
In seinem Werk Die Uranmaschine. Mythos und Wirklichkeit der deutschen Atombombe (1990) schreibt der US-Wissenschaftshistoriker Mark Walker, die deutschen Physiker im Dritten Reich hätten «eindeutig das Prinzip zur Herstellung nuklearer Sprengstoffe wie auch die Funktion von Kernwaffen verstanden». Die Atombombe sei vor allem aus wirtschaftlichen Gründen nicht entwickelt worden. Dem widerspricht US-Geheimdienstexperte Thomas Powers in seinem Buch Heisenbergs Krieg (1993). Demnach habe der Nobelpreisträger die Entwicklung quasi sabotiert und trotz Kenntnis der richtigen Werte die kritische Masse unerreichbar hoch erscheinen lassen. Für den amerikanischen Historiker Paul L. Rose (Heisenberg und das Atombombenprojekt der Nazis, 2001) war der Kernforscher hingegen ein unfähiger Nazi, der die Bombe entwickeln wollte, jedoch scheiterte.
Doch die Gruppe um Heisenberg war beileibe nicht die nicht die einzige und erst recht nicht die führende Kapazität auf dem Gebiet der Atomforschung. So verfügten auch das Marinewaffenamt unter Leitung von Generaladmirals Karl Witzell und die Luftwaffe über eigene Kernforschungseinrichtungen, in denen die Nuklearkraft vor allem als mögliche Antriebsart erforscht werden sollte. Von der Arbeit beider Ämter haben jedoch nur wenige Aktenfragmente das Kriegsende überdauert.
Unterschätzt wird aber vor allem die Rolle der Reichspost, deren Leiter Wilhelm Ohnesorge, wohl auch aufgrund seiner guten Kontakte zu Hitler, eine Reihe kriegswichtiger Projekte übernahm. Hier war unter anderem der Physiker Manfred von Ardenne tätig, der in Berlin ein Zyklotron-Labor – also eine Einrichtung mit Teilchenbeschleuniger – betrieb. Bereits 1941 hielt der Leiter der Reichspostforschungsanstalt (RPF), der Elektroingenieur Professor Friedrich Gladenbeck, eine Vorlesung für Offiziere der Wehrmacht mit dem aussagekräftigen Titel «Die Bedeutung der Atomspaltung für den Bau einer Bombe mit bisher unbekannter Explosionskraft». Wie erfolgreich die Wissenschaftler des RPF waren, ist umstritten. Möglicherweise war es ihnen gelungen, an einem bis heute unbekannten unterirdischen Standort im Harz Uran anzureichern. Dies sagte Hitler laut Henry Pickers Aufzeichnungen (Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier) bereits Ende 1943: «Die Serienfertigung dieser kleinen Atombombe sollte in einem unterirdischen SS-Werk im Südharz» anlaufen, womit die Forschungseinrichtung SIII am Truppenübungsplatz Ohrdruf im Jonastal gemeint gewesen sein könnte. Der NS-Diktator meinte mit «dieser kleinen Bombe» vermutlich eine Uranwaffe, für deren Herstellung man – anders als bei einer Plutoniumbombe – keinen Atomreaktor benötigte, den es frühestens 1944 gegeben haben kann. Es reichte, Uranium durch Isotopentrennung anzureichern. Der Physiochemiker betrieb an der Universität Hamburg einen Uranmeiler und hatte dort 1940 das weltweit erste Reaktor-Experiment durchgeführt. Mit den von ihm entwickelten Zentrifugen, Heisenbergs Zyklotron sowie den Isotopenschleusen des HWA-Kernphysikers Erich Bagge standen den Deutschen gleich mehrere Möglichkeiten zur Urananreicherung zur Verfügung, während die Amerikaner noch die viel langsamere Methode der Gasdiffusion verwendeten.
Atom-Blitz über Thüringen
Der wichtigste Mann der deutschen Atomforschung blieb jedoch trotz großer Erfolge Ardennes bei der RPF offenbar der Kernphysiker Diebner. Zwar trat er 1942 als Geschäftsführer des KWI für Physik zurück, arbeitete jedoch schon seit 1939 an der HWA-Versuchsstelle Gottow an thermonuklearen Reaktionen durch Hohlladungen. Ab Januar 1944 wurde er Stellvertreter des Beauftragten des Reichsforschungsrates für die kernphysikalische Forschung, Professor Walther Gerlach, in Berlin-Dahlem. Mit dessen Unterstützung setzte Diebners Team seine Arbeiten fort. Bis Frühjahr 1944 liefen die Vorbereitungen an einem Reaktorexperiment in der Gottower Anlage, die aber laut Aussagen des Versuchsleiters nach dem Krieg erfolglos abgebrochen worden seien.
Im März 1945 soll laut Himmlers Adjutant ein SS-eigener Uran-Reaktor angelaufen sein.
Wie allerdings der Historiker Rainer Karlsch in seinem Buch Hitlers Bombe. Die geheime Geschichte der deutschen Kernwaffenversuche (2005) ausführte, wurde die Anlage in Gottow bis Herbst 1944 weiter betrieben, nämlich so lange, bis der Mehrstufenreaktor im vierten Anlauf (Versuch G-IV) endlich zum Laufen gebracht war. Warum aber verschwieg Diebner, der bereits nach dem vorangegangenen Versuch G-III seine Vorgesetzten über die kurzfristige Realisierung einer Atombombe informiert hatte, diesen Erfolg? Dieses Schweigen muss umso mehr erstaunen, als er Mitte 1955, unmittelbar nach Aufhebung des alliierten Verbots der Atomforschung in der BRD, ein Patent auf den Bau eines zweistufigen Reaktors anmeldete – eines Reaktors, der jenem von 1944 auffällig ähnelte.
Wie Thomas Mehner und Edgar Mayer in ihrem Buch Geheime Reichssache. Thüringen und die deutsche Atombombe (2004) schreiben, war es der Mannschaft um Diebner oder parallel forschenden Gruppen in den letzten Kriegsmonaten gelungen, doch noch eine Kernwaffe zu bauen. Während die offizielle Darstellung die Bemühungen deutscher Wissenschaftler im deutsch-amerikanischen Wettlauf um die Atombombe im Juni 1942 enden lässt, wurde tatsächlich weiter geforscht und wohl im Sommer 1944 ein Durchbruch erzielt, der zum «Prototypen» einer Nuklearwaffe führte, die kurz darauf getestet worden sein soll. Dies geschah Mehner und Mayer zufolge auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf, wie auch Karlsch feststellt.
Die Tochter der früheren Hausverwalter der nordwestlich von Arnstadt gelegenen Wachsenburg, Cläre Werner, beobachtete am 4. März jenes Jahres über dem Truppenübungsplatz Ohrdruf ein Licht, dass «tausendmal heller gewesen sei als normale Blitze», wie das Magazin Nexus in seiner Ausgabe vom Februar/März 2014 mit Bezug auf ein Stasi-Verhörprotokoll von 1962 schreibt. Die kurze Explosion sei «innen rot und außen gelb» gewesen. Am folgenden Tag hätte sie ebenso wie viele andere Anwohner unter Nasenbluten, Kopfschmerzen und einem unangenehmen Ohrendruck gelitten. Am Nachmittag, so die Augenzeugin weiter, seien dann 100 bis 150 Wehrmachts- und SS-Männer im Ort eingetroffen, um Leichen zu beseitigen. Bei diesen habe es sich um bei dem Test umgekommene Insassen des Zwangsarbeiterlagers Ohrdruf gehandelt. Diese Angaben bestätigte der Zeuge Heinz Wachsmut, der gegenüber einem DDR-Untersuchungsausschuss erklärte, dass er an diesem Tag ebendort gemeinsam mit Soldaten und Häftlingen «Häftlingsleichen mit starken Brandwunden auf Holzstößen verbrannt» hätte. Überlebende des mutmaßlichen Waffentests hätten ihm von einem gewaltigen Feuerblitz erzählt, der die Verletzungen verursacht hätte. Schließlich habe ihm nach der Aktion ein SS-Mann anvertraut, dass die Häftlinge Opfer einer «neuen Waffe» geworden wären, «von der die Welt noch viel hören werde.»
Das Produktionswerk Bergkristall erstreckte sich auf mehreren Ebenen über 40 Kilometer.
Laut einem Artikel der Zeit sollen fünf Physikprofessoren durch Messungen bestätigt haben, dass «in Ohrdruf Spuren eines nuklearen Ereignisses vorhanden» seien. Karlsch hält die damals verwendete Waffe für eine Art schmutzige Bombe, also eine konventionelle Spreng- beziehungsweise Hohlladung, die mit radioaktivem Material angereichert war, das durch die Sprengung eine thermonukleare Fusion auslösen sollte. Ähnlich die Einschätzung des britischen Wissenschaftshistorikers Mark Walker (Die Uranmaschine. Mythos und Wirklichkeit der deutschen Atombombe, 1990), der meint, die verwendete Waffe sei, «nicht mit den Atombomben zu vergleichen, die im folgenden August über Japan abgeworfen werden sollten», aber immerhin einräumt, «dass eine Gruppe deutscher Wissenschaftler nach eigenem Dafürhalten zweifellos eine Kernwaffe entwickelte und testete».
100 Gramm Plutonium
«Man muss sich von der Vorstellung lösen, der Test sei mit einer Waffe im Format von Hiroshima geschehen. Nach Zeugenaussagen war es nur eine kleine Waffe, angeblich eine 100-Gramm-Ladung. Natürlich haben mich Physiker angesprochen und gesagt, dass das unmöglich sei. Allerdings gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die eindeutig bestätigt, dass die kleinste Ladung, die man zünden kann, eine 100 Gramm Plutoniumladung ist. (…) Außerdem haben wir Luftaufnahmen, die das Testgelände vor und nach dem Einsatz zeigen, und da sieht man eine geradezu abrasierte Fläche nach der Explosion. (…) Es gibt Aussagen von im dortigen Umkreis lebenden Menschen, die berichten, dass sie von einem aus dem Ufer gelaufenen Experiment gehört haben; diese Leute hatten Kopfschmerzen, Nasenbluten und andere Symptome, die auf eine leichte Verstrahlung hindeuten, und man erzählte ihnen, es wäre eine Epidemie ausgebrochen. Die Betroffenen wurden, was ebenfalls ungewöhnlich war, von SS-Ärzten behandelt. Was die Radioaktivität anbelangt, so haben oberflächliche Untersuchungen nichts erbracht. Eine Information seitens des Strahlenschutzes hat ergeben, dass nach einer Kleinstexplosion wenig zurückbleibt, weil vor allem kurzlebige Nukleoide entstehen.» (Thomas Mehner, Autor mehrerer Bücher über das Jonastal und die deutsche Atombombenforschung, zur Test-Explosion am 4. März 1945 auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf, Junge Freiheit, 11.1.2002)
Christel Focken und Rolf-Günter Hauck schreiben in ihrer Studie Atombombe – Made in Germany. Georadarmessungen liefern neue Erkenntnisse (2017), dass Untersuchungen, die zwischen 2012 und 2016 von dem Ingenieur Peter Lohr durchgeführte Georadarmessungen von Objekten innerhalb unterirdischer Stollen im Jonastal ebenfalls darauf deuteten, dass dort nukleare Sprengkörper gefertigt und gelagert wurden. Dafür spreche laut Lohr sowohl die äußere Kontur als auch die sehr ungewöhnliche, asymmetrische Dichteverteilung mehrerer gemessener Objekte. Diese sei bei konventionellen Bomben aufgrund ihrer recht homogenen Sprengstofffüllung nicht erklärbar und könnte auf eine Atombombe nach dem Kanonen-Konstruktionsprinzip von «Little Boy», die auf Hiroshima abgeworfen wurde, hindeuten.
Die Bombe der SS
Diebner und Gerlach hielten die neue Waffe und den damit verbundenen Test streng geheim. Keiner der anderen am Uranprojekt beteiligten Wissenschaftler, noch nicht einmal Heisenberg und von Weizsäcker, erfuhren etwas davon. Es gibt indes noch weitere Hinweise darauf, dass die deutsche Atomwaffenforschung schließlich zum Erfolg führte:
- US-Dokumente führen unter Gegenständen, die bei Kriegsende im thüringischen Stadtilm beschlagnahmt wurden, unter anderem auch eine «Kleinst-Atombombe» auf. In der nahe Ohrdruf gelegenen Gemeinde hatte Diebner im Herbst 1944 ein Versuchslabor eingerichtet und mit Uranwürfeln experimentiert. Ein Grund für den Wissenschaftler, nichts davon zu erwähnen, könnte mit seiner Schweigeverpflichtung gegenüber der diese Nukleartests kontrollierenden Gruppe zusammenhängen: SS-Männern unter Leitung des 1943 zum Sonderbeauftragten für alle V-Waffen ernannten Hans Kammler.
- Wie Thomas Mehner und Edgar Meyer nach jahrelangen Recherchen herausfanden, hatten sogar mehrere Gruppen Erfolg bei der Herstellung von Atombomben, sodass mindestens drei verschiedene Typen solcher Waffen fertiggestellt wurden – zwei davon unter Ägide der SS. Ihren Ausführungen in Die Angst der Amerikaner vor der deutschen Atombombe (2007) zufolge hatte Himmlers Truppe bereits 1939 im Raum Köln-Bonn eine Forschungsgruppe zur Entwicklung atomarer Waffen eingerichtet, die während des Krieges um andere geheime Einrichtungen im thüringischen Ohrdruf sowie im böhmischen Pilsen – und möglicherweise sogar bei Auschwitz – erweitert wurde, um 1944 erste «einsatzbereite Waffensysteme liefern zu können».
- Genau in diesem Jahr, zeitgleich zum wahrscheinlichen Durchbruch, den Diebner und SS-Ingenieur Dr. Seiffert im Juli 1944 beim Bau einer Atombombe erzielten, übernahm Kammler schrittweise die Kontrolle über die gesamte Atom-Forschung. Laut dem Historiker Günter Nagel (Himmlers Waffenforscher. Physiker, Mathematiker und Techniker im Dienste der SS, 2011) enthüllte Himmlers früherer Chefadjutant (seit 1. April 1942), SS-Sturmbannführer Werner Grothmann, im Jahr 2000, dass an der Nuklearforschung unter der Regie der Schwarzuniformierten 5.000 Personen an diversen Projekten arbeiteten, auf die nur wenige SS-Offiziere Zugriff hatten. Die verschiedenen Gruppen – neben Diebner und Gerlach wird auch ein österreichisches Physiker-Team unter Leitung von Professor Georg Stetter erwähnt – wurden von einer SS-Koordinierungsstelle kontrolliert, von der sich Himmler regelmäßig über den aktuellen Stand der Forschung unterrichten ließ. Im März 1945 soll Grothmann zufolge sogar ein SS-eigener Uranreaktor angelaufen sein.
Der Alpen-Reaktor
Wo genau sich diese Einrichtung befunden haben soll, dazu schwieg Himmlers früherer Chefadjutant. Inzwischen liegen jedoch neue Erkenntnisse vor, nach denen sich der Kernreaktor im Gebiet der sogenannten Alpenfestung befunden haben könnte – und zwar bei St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich. Dort wurde von einem Filmteam ein auffälliges Beton-Oktogon ausfindig gemacht, das an einen Reaktoraufbau erinnert. Unweit des mysteriösen Bauwerks befand sich das unterirdische Produktionswerk Bergkristall, das offiziell nur Me-262-Düsenjets produzieren sollte.
«Hitlers Krieg im Februar 1945 war nicht abwegig, denn was wir in Deutschland fanden, hätte wenige Monate später dem Kampf einen anderen Ausgang gegeben.» US-Admiral Zacharias
Die Macher der vom ZDF produzierten Doku Die Suche nach Hitlers Atombombe (2015) präsentierten Baupläne belegen jedoch, dass sich das Werk anders als bislang angenommen, nicht eingeschossig über acht Kilometer erstreckte, sondern auf mehreren Ebenen fast 40 Kilometer umfasste. Hier sollten laut dem Experten Matthias Uhl nicht nur Düsenjäger, sondern die tatsächlichen deutschen Wunderwaffen produziert werden, um den Kriegsausgang im letzten Moment noch zu wenden. Und die wichtigste Waffe davon war zweifelsohne die Atombombe.
Neben all diesen klaren Indizien für einen erfolgreichen Abschluss des Atombombenprogramms unter Hitler gibt es auch Hinweise in alliierten Militärberichten. So erklärte kein Geringerer als US-Generalstabschef George C. Marshall, dass die Landung in der Normandie im Juni 1944 auch wegen der Entwicklung atomarer Sprengstoffe in Deutschland dringend erforderlich war. Auch US-Politiker wie Senator E. D. Thomas warnten eindringlich vor der Gefahr einer deutschen Atombombe. Schließlich bestätigte US-Admiral Ellis M. Zacharias dies quasi offiziell, als er gegenüber der Chicago Daily Tribune (28.9.1945) erklärte: «Hitlers Krieg im Februar 1945 war nicht abwegig, denn was wir in Deutschland fanden, hätte wenige Monate später dem Kampf einen anderen Ausgang gegeben.»
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 106.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 106.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: