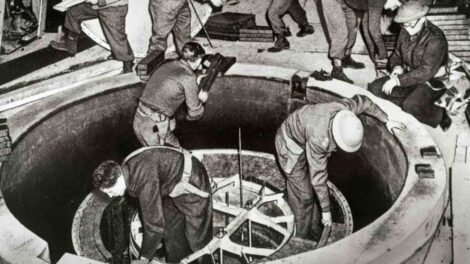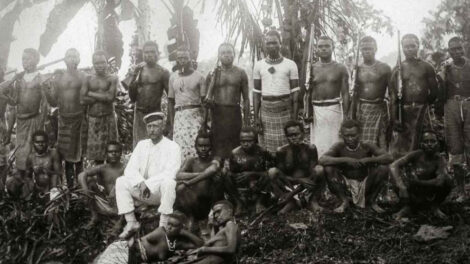Die Bezieher von Einkommen aus Aktiendividenden, Pachten und Zinsen erbringen selbst keine Leistung, sondern erhalten Jahr für Jahr eine Prämie für ihr Vermögen. Dies ist oft lediglich ererbt und nicht erarbeitet. Bezahlen muss die gesamte Gesellschaft, in einem Ausmaß, das selten beleuchtet wird.
Laut dem jüngsten Vermögensbericht der UBS-Bank gehört die halbe Erdkugel, das heißt Boden, Immobilien, Unternehmen und Zinspapiere den reichsten 2 Prozent aller Menschen. Etwa neun Zehntel allen physischen Eigentums ist in Händen der oberen 20 Prozent. Die unteren 80 Prozent teilen sich etwa ein Zehntel aller Vermögen, und die untere Hälfte kommt auf etwa ein Prozent allen Besitzes. Somit fließen etwa die Hälfte aller Mieten, Pachten, Unternehmensgewinne, Dividenden und Zinsen an die oberen 2 Prozent der Menschheit.
In Deutschland sieht es ähnlich aus: Das oberste Prozent besitzt 30 Prozent aller Vermögen, den wohlhabendsten 10 Prozent gehören über 60 Prozent aller Immobilien, Aktien und Geldpapiere. Die untere Hälfte der Bevölkerung verfügt über lediglich 3 Prozent allen Eigentums.
In den letzten 45 Jahren hat die Vermögenskonzentration weltweit und auch in Deutschland zugenommen. Besonders beeindruckend zeigt sich das in den USA. Laut Angaben der US-Notenbank besaßen die reichsten 0,1 Prozent dort 1989 9 Prozent aller Vermögen. Heute gehören ihnen 14 Prozent. Das oberste eine Prozent hatte 1989 23 Prozent aller Vermögen, heute gehören ihm 31 Prozent. Im Gegenzug sank der Anteil der unteren 50 Prozent im selben Zeitraum von 4 auf 3 Prozent aller Vermögen.
Auch bei den Einkommen geht die Schere zwischen arm und reich für die meisten Menschen auf der Erde seit den 1980er Jahren immer weiter auf. So stieg der bevölkerungsgewichtete weltweite Einkommens-Gini-Index – eine Messkennziffer für die Ungleichverteilung – von 1990 bis 2015 von 37 auf 41. Das gleiche gilt für Deutschland: Der deutsche Gini-Index ist heute deutlich höher als 1984. Bei uns fließen derzeit auf die Girokonten der oberen 10 Prozent der Einwohner 37 Prozent aller Einkommen, die unteren 50 Prozent teilen sich 19 Prozent aller Einkünfte. Die oberen 10 Prozent der Bevölkerung verdienen pro Jahr 10 Mal so viel wie die Menschen in der unteren Hälfte der Haushalte in Deutschland.
Das alles klingt nicht sehr gerecht und ist es auch nicht. Wie funktionieren die Markt-Mechanismen, die zu solchen Zuständen führen? Die Wirkungsweisen der tagtäglichen Umverteilung von den Vielen zu den Wenigen soll an Hand zweier Beispiele aufgezeigt werden: Mercedes-Benz und Vonovia. Die Mechanismen sind in dieser oder ähnlicher Form aber bei fast allen Unternehmen gleich, vor allem bei den börsennotierten oder anderen gewinnmaximierenden Unternehmen.
Die tägliche Umverteilung
Beispiel Mercedes: Mercedes-Benz zahlte seinen etwa 175.000 Beschäftigten 2024 Löhne und Gehälter in Höhe von 17 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern betrug 10 Milliarden. Für das Geschäftsjahr 2024 wurden 4 Milliarden Euro Dividende ausgezahlt und 3 Milliarden sind in Aktienrückkäufe geflossen. Insgesamt sind an die Aktionäre also 7 Milliarden ausgezahlt worden, denn Aktienrückkäufe sind lediglich eine andere Form, den Aktionären Geld zu überweisen. Hätte man das Geld für die Dividenden und die Aktienrückkäufe der Belegschaft ausbezahlt, so hätte jeder Beschäftigte 2024 eine Lohnerhöhung von 41 Prozent bekommen. Jeder.
2023 wurden von Mercedes 9 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausbezahlt. Wäre dieses Geld an die Beschäftigten geflossen, hätte jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin eine Lohn- oder Gehaltserhöhung von 56 Prozent bekommen. Für 2022 wurden 6 Milliarden an Dividenden ausgeschüttet, da hätten die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 34 Prozent haben können.
Im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre 2022 bis 2024 hätte die Belegschaft, wenn all das Geld, das an die Aktionäre geflossen ist, stattdessen an die in den Werken arbeitenden Menschen ausgezahlt worden wäre, 44 Prozent Lohnerhöhung haben können. Jeder, vom Abteilungsleiter bis zum einfachen Werker im Blaumann. 44 Prozent Lohnerhöhung in jedem der drei vergangenen Jahre.
Wer bekam stattdessen das viele Geld? Die Eigentümer, die Aktionäre. Wer sind die Aktionäre von Mercedes-Benz? Die größten Aktionäre sind laut Unternehmensangaben die chinesische BAIC Group mit 10 Prozent aller Aktien sowie der chinesische Anleger Li Shufu, der über eine Holdinggesellschaft (Tenaciou 3) ebenfalls 10 Prozent an Mercedes hält. Drittgrößter Aktieneigentümer ist die Kuwait Investment Authority mit 6 Prozent. Der Rest sind zum größten Teil so genannte Institutionelle Investoren, das sind internationale Großanleger wie BlackRock, Vanguard oder DWS. 7 Prozent aller Aktien im Eigentum von institutionellen und strategischen Investoren werden von deutschen Anlegern gehalten, gut 93 Prozent Prozent von internationalen Eigentümern. Die meisten Aktionäre wissen also vermutlich nicht so genau, wie man Sindelfingen oder Untertürkheim buchstabiert und haben die Werke im Normalfall selten oder nie von innen gesehen, weil sie sehr weit weg wohnen.
Dabei muss man sich darüber klar sein, dass die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe nicht die gesamten Erträge sind, die die Aktionäre bekommen. Denn von den tatsächlich erwirtschafteten Gewinnen wird immer nur ein Teil ausgeschüttet oder für Aktienrückkäufe verwendet, meist etwas weniger als die Hälfte aller Gewinne. Die Unternehmensgewinne waren bei Mercedes in den letzten Jahren immer noch weitaus höher als der an die Eigentümer ausgezahlte Betrag. Vergleicht man die gesamte Konzern-Wertschöpfung und ihre Aufteilung auf Arbeit und Kapital, so bekamen die arbeitenden Menschen in den letzten drei Jahren 2022 bis 2024 56 Prozent der Wertschöpfung ab, die nicht im Unternehmen arbeitenden weit weg wohnenden, reichen Aktionäre 44 Prozent.
Anders ausgedrückt: Eine Mercedes-Ingenieurin, die in den beiden letzten Jahren 8.000 Euro im Monat verdiente, erwirtschaftete in den letzten drei Jahren für Mercedes etwa 14.300 Euro im Monat. Von diesen 14.300 Euro bekam sie 8.000 und die Aktionäre 6.300 Euro. Man nennt das leistungslose Einkommen, Nicht-Arbeits-Einkommen, passive oder Rentier-Einkommen. Den arbeitenden Menschen wird also knapp die Hälfte ihres Lohnes abgenommen und an die Aktionäre übertragen.
Welchen Beitrag leistet der Aktionär?
Warum eigentlich? Welchen Beitrag leistet der Aktionär heute? Ich spreche nicht von Unternehmensgründern, von echten Entrepreneuren, die aufbauen, unermüdlich arbeiten und schaffen. Solche Entrepreneur-Kapitalisten sind echte Unternehmer und ein Segen für die Gesellschaft. Sondern es geht hier ausschließlich um die Aktionäre an Wall Street oder an der Frankfurter Börse. Solche reinen Finanzanleger, Spekulanten oder Renten-Kapitalisten (rent seeking capitalists) kaufen ohne jegliches Unternehmer- oder Entrepreneurtum an der Börse einmalig für einen Geldbetrag Aktien und bekommen dann, solange das Unternehmen existiert, einen Dividendenstrom. Kauft man ETFs (Exchange Traded Funds) auf Aktienindizes, so ist dieser Dividendenstrom ewig. Denn jedes Mal wenn ein Unternehmen underperformed, wird es aus dem Index entfernt und durch ein gewinnstärkeres ersetzt. Kauft man sich heute in einen Aktienindex ein, bekommt man also buchstäblich ewige Renten. Auch die Urenkel brauchen dann nur die Hand aufzuhalten beziehungsweise vom Konto abzuheben. Das sind leistungslose Einkommen in Reinform. Sie laufen unendlich.
Diese tagtägliche Umverteilung von allen Arbeitenden zu wenigen Wohlhabenden klingt nicht sehr gerecht. Auf diese Ungerechtigkeiten wies bereits Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfschulen, 1919 hin: „Woher kommen die Schäden im sozialen Leben? (…) Davon, (…) dass wir nicht bemerken, wie wir in der Lebenslüge leben, wie dem Arbeiter sein Teil abgenommen wird. (…) Das heißt ihn betrügen, ihn übervorteilen.“ Das bringt den Mechanismus, der still und heimlich fast im gesamten Wirtschaftsleben abläuft, gut auf den Punkt.
Beispiel Vonovia: Vonovia ist das größte in Deutschland ansässige Immobilienunternehmen, das Wohnungen vermietet. Es bewirtschaftet derzeit laut Geschäftsbericht mit etwa 12.000 Beschäftigten 613.000 Wohnungen, davon ungefähr 540.000 im Eigenbestand. Der größte Teil davon befindet sich in Deutschland: 85 Prozent aller Mieteinnahmen stammen von hier. Die durchschnittliche Monatsmiete lag 2024 bei 8 Euro pro Quadratmeter. Die Mieten wurden von Vonovia 2024 um 4 Prozent erhöht.
In den letzten vier Jahren stiegen die Mieteinnahmen von 2.572 Millionen Euro 2021 auf 3.332 Millionen Euro 2024. In Summe beliefen sich die Mieteinnahmen in diesen vier Jahren auf 12.331 Millionen Euro. Für diese vier Geschäftsjahre wurden insgesamt Dividenden in Höhe von 3.716 Millionen Euro ausgeschüttet.
Teilt man die ausgeschütteten Dividenden der letzten vier Jahre durch die Summe der Mieteinnahmen, so erhält man 30 Prozent. Das heißt 30 Prozent der Mieten der letzten vier Jahre sind direkt durchgeleitet worden an die Aktionäre von Vonovia. Wer sind die Aktionäre? Laut Unternehmensangaben waren im März 2025 89 Prozent der Aktien in Händen von Institutionellen Investoren, 11 Prozent waren in Privatvestitz. Von den Institutionellen Investoren kamen 9 Prozent aus Deutschland, 91 Prozent waren internationale Eigentümer. Der Großteil der Aktionäre kennt also vermutlich gar nicht so genau die Namen der Städte, in denen sich die Wohnungen befinden, die Aktionäre wissen im Normalfall nicht, wo die Immobilien genau sind, denn sie betreten sie üblicherweise nie und kümmern sich auch nicht um sie. Das besorgen die Hausmeister, Handwerker und andere Werktätige.
Wenn man auf die Dividenden verzichtet hätte, dann hätten die Mieten in den letzten vier Jahren um 30 Prozent niedriger sein können. 30 Prozent! Wären die über 600.000 Wohungen statt im Besitz von Vonovia im Besitz einer Genossenschaft, eines gewerkschaftlichen oder christlichen Wohnungsverbands oder einer gemeinwohlorientierten Stiftung, so hätten die Mieten also um 30 Prozent niedriger sein können. Statt der derzeitigen 8 Euro Monatsmiete kalt pro Quadratmeter könnten die Mieten heute bei 5,60 Euro liegen. Bei einer 100-Quadratmeter-Wohnung wäre die Monatsmiete dann statt 800 Euro nur noch 560 Euro.
Laut Angaben des Deutschen Mieterbundes wohnt über die Hälfte der Menschen in Deutschland zur Miete: „Von den 21 Millionen Mieterhaushalten ist über ein Drittel deutlich durch Wohnkosten überlastet. 3,1 Mio. Haushalte zahlen für Kaltmiete und Heizkosten mehr als 40 Prozent ihres Einkommens. 4,3 Mio. Haushalte zahlen zwischen 30 und 40 Prozent ihres Einkommens. Mietende Haushalte verfügen im Schnitt über weniger Wohnfläche als der Bundesdurchschnitt und wohnen überwiegend in Mehrfamilienhäusern.“
Was findet also auf dem deutschen Wohnungsmarkt durch Vonovia statt? Die ärmeren Bevölkerungsteile, die sich wenig Wohnraum leisten können und oft einen erheblichen Teil ihres Einkommens für Miete ausgeben müssten, subventionieren die im Normalfall reichen, weit weg wohnenden Aktionäre.
Und was genau tragen die Aktionäre zum Erhalt der Wohnungen bei? Nichts. Sie halten, wie oben geschildert die Hand auf beziehungsweise geben ihr Girokonto an. Das ist in Wirklichkeit die einzige Tätigkeit. Sie müssen dafür nicht arbeiten, wissen im Normalfall auch nicht, wo die Wohnungen sind oder wer darin wohnt. Denn die Dividendenzahlungen werden automatisch leistungslos überwiesen. Es ist ein perfekt, geräuschlos funktionierendes System der Umverteilung von unten nach oben.
Nun könnte man die Frage stellen: Warum müssen die Mieter einen derart hohen Aufschlag an die Aktionäre zahlen? Warum findet für das Grundlebensbedürfnis Wohnen ein Transfer von den Armen zu den Reichen statt? Warum wird hier täglich ein Tribut, eine Abgabe entrichtet?
Logisch konsequent zu Ende gedacht existiert gar kein Mietproblem, sondern ein Boden-Eigentums-Problem. Das eigentliche „Mietproblem“ ist, dass das Bodeneigentum sehr stark konzentriert ist in den Händen von recht wenigen Menschen. In Österreich beispielsweise – für Deutschland sind diese Zahlen selbst von Experten leider nicht herauszubekommen, sie werden gut geheim gehalten – gehören 10 Prozent des gesamten Bodens 100 österreichischen Familien. Möglicherweise sind die Eigentumsverhältnisse in Deutschland ähnlich.
Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen
Die geschilderten tagtäglichen Umverteilungsprozesse führten in den letzten etwa 45 Jahren dazu, dass die Einkommensschere in den meisten Ländern, insbesondere in den Indutrieländern, immer weiter aufging und die Masseneinkommen nicht Schritt hielten mit der Massenproduktion.
Ein paar Zahlen dazu aus den USA: Das reale BIP, also die reale Wirtschaftskraft pro Kopf der USA, wuchs von 1980 bis 2023 um 110 Prozent also von 100 auf 210. Die realen, inflationsbereinigten Medianeinkommen stiegen im gleichen Zeitraum dagegen nur etwa halb so stark, um 60 Prozent, von 100 auf 160. Medianeinkommen sind diejenigen Einkommen, die die Menschen genau in der sozialen Mitte bekommen, wenn die eine Hälfte der Bevölkerung mehr und die andere Hälfte weniger verdient.
Da stellt sich die Frage: Von welchem Geld haben die Menschen in den USA alle die Güter und Dienstleistungen gekauft? Wie geht es, dass man 110 Prozent mehr produziert und verkauft, aber die Masse der Menschen, die die genau in der Mitte der Einkommensverteilung sind, nur 60 Prozent mehr Geld haben? Wer hat eigentlich die ganzen zusätzlichen Burger gegessen? Wer hat die vielen neuen Autos, Bildschirme, Kühlschränke, die produziert wurden, eigentlich mit welchem Geld gekauft? Denn Massenproduktion ist in einer Industriegesellschaft nur möglich, wenn Massennachfrage zur Verfügung steht. Massennachfrage ist auf Dauer nur möglich, wenn Masseneinkommen vorhanden sind. Die Masseneinkommen in Form von Medianeinkommen sind aber nur gut halb so stark gestiegen wie die Produktion.
Die Antwort ist einfach: Die vielen zusätzlichen schönen Güter und Dienstleistungen wurden zum guten Teil über Kredite gekauft. Die Leute sind shoppen gegangen, ohne eigentlich genügend Geld dafür zu haben. Zu Beginn der 1980er Jahre lagen die Schulden der Regierungen, Unternehmen und privaten Haushalte weltweit bei etwa 115 Prozent der Wirtschaftskraft, des Welt-Bruttoinlandsproduktes. 2023 lagen sie bei 237 Prozent, also mehr als doppelt so hoch.
Aufgrund der zunehmenden Ungleichverteilung entstand also weltweit ein fast zur Hälfte auf Pump und damit auf Sand gebautes Wirtschaftswachstum. Die Masseneinkommen und damit Massennachfrage hat mit der Produktion nicht Schritt gehalten. Real betrachtet ist also weltweit viel zu viel Produktionskapazität vorhanden. Oder anders ausgedrückt: Da ist eine gewaltige Nachfragelücke aufgebaut worden, die nun möglicherweise vor einer Bereinigung steht. Denn dieser hohe Schuldenberg dürfte auf Dauer nicht haltbar sein, zumal, da nach einer fast 15-jährigen Niedrigzinsphase im Gefolge der Finanzkrise 2008, seit 2022 die Zinsen weltweit wieder stark angestiegen sind. Also man könnte die Frage stehen: Tanzen wir – rein ökonomisch gesehen – auf einem Vulkan?
Der oben bereits erwähnte Rudolf Steiner wies interessanterweise bereits 1914 auf diese Entwicklungen mit eindringlichen Worten hin: „Es wird also heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert (…) und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich (…) in sich selbst vernichten wird. Es entsteht dadurch (…) im sozialen Zusammenhang der Menschen auf der Erde genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn so ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe, eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom!“ Das bringt die Sache gut auf den Punkt.
Was ist also in den letzten 40 bis 45 Jahren in der Weltwirtschaft geschehen? Wir sehen krebsartiges Wachstum. Die oben geschilderten hohen leistungslosen Einkommen fließen von allen zu wenigen. Die Wohlhabenden, vor allem die Superreichen, können das viele Geld nicht ausgeben, suchen nach immer neuen Anlagemöglichkeiten für Produkte und Dienstleistungen, die schon lange niemand mehr braucht oder sich nicht mehr leisten kann. Trotzdem wird über riesigen Werbeaufwand und Kredit der Konsum weiter künstlich angeheizt. Dies alles ist nicht gesundes, sondern krankes, krebsartiges Wachstum, das zu Krankheit im sozialen Organismus führt. Es scheint so, als ob wir heute ökonomisch wieder vor einer solch gefährlichen Situation wie 1914 oder 1929 stehen könnten.
Scheinbegründung für leistungslose Einkommen
Das Standardargument für leistungslose Einkommen aus Dividenden und Aktienrückkäufen lautet: diese passiven, rent-seeking Anleger übernähmen ein Risiko, das Risiko des Kapitalrückganges oder gar Totalverlustes und dafür müssten sie kompensiert werden.
Das Argument hinkt aber. Die Beschäftigten tragen auch ein Risiko, sie können bei Wirtschaftsabschwüngen entlassen werden und haben dann Probleme aller Art, wie vergangene Wirtschaftskrisen zeigen. Beispielsweise war die Krise 2008-2009 für viele Arbeitslose, für viele Familien schlimm. Für dieses Risiko fordert aber niemand eine Risikoprämie in Form eines Lohnaufschlags oder Unternehmensbeteiligungen. Dieses Arbeitslosigkeits-Risiko muss stillschweigend von jedem abhängig Beschäftigten in Kauf genommen werden, man sagt „that’s life“ und thematisiert die Frage der Rentier-Einkommen lieber nicht weiter, weil sie zu unbequem ist und es recht heikel wird, wenn man die Sache zu Ende denkt. Denn hier geht es um Machtfragen, nicht um Moral oder Ökonomie.
Letztlich liegt es an den Machtverhältnissen. Das Investorengeld, die Finanz-Portfolios sind frei, zu wandern, wohin sie wollen, auch über Landesgrenzen hinweg und in andere Anlageformen. Die meisten Beschäftigten sind nicht frei. Sie müssen arbeiten, um sich oder ihre Familien zu ernähren.
Monopoly und die Bodenrenten
Das gleiche gilt für für die Bodenrenten. Da man für alles und jedes Grund und Boden braucht, zum Wohnen, Arbeiten, für Freizeit, Fortbewegung, Essengehen, Einkaufen und so weiter, sind die Bodenrenten in Form von Mieten und Pachten garantiert. Sie stellen eine Knappheitsrente dar, für die man nichts tun muss – außer im Grundbuch zu stehen. Es ist wie beim Monopoly-Spiel: Fast egal, auf welches Feld man kommt, man muss dafür zahlen. Wenn man selber keine Straßen und Häuser hat, wie das bei der Mehrheit der Menschen in Deutschland der Fall ist, zahlt man alles an die anderen.
Letztlich liegt der Grund für die permanent steigenden Bodenpreise und damit auch für die ständig steigenden Mieten darin, dass Boden ein nicht vermehrbares, „superiores Gut“ ist (ein Gut, das man bei steigendem Einkommen vermehrt nachfragt). Bei offiziellem Wirtschaftswachstum steigt daher der Bodenpreis von ganz allein und automatisch stärker als die Wachstumsrate des nominalen Sozialproduktes – ohne dass man irgendetwas dafür tun muss.
Die Zahlungen für die Bodenrenten fließen nicht nur durch die Mieter, sondern auch durch jeden Produkt- und Dienstleistungskauf. So sind beispielsweise in jedem Produkt, das wir kaufen, Bodenrenten in Form von Mieten oder Pachten als Teil des Kaufpreises enthalten. Mit jedem Produkt, das wir kaufen, zahlen wir die Bodenbenutzung, die für seine Erstellung nötig ist, mit, ob wir es wissen oder nicht und ob wir es wollen oder nicht. Also auch Familien, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen und keine Miete überweisen, zahlen tagtäglich Bodenrenten an die Bodeneigentümer.
Das Gleiche gilt für Zinsen und Unternehmensgewinne. In jedem Produkt, das wir kaufen, stecken Zinsen und Gewinnmargen. Mit jedem Produktkauf zahlen wir ständig an die Eigentümer von Kapital und Boden. Wir zahlen täglich Zinsen, auch wenn wir gar keine Kredite aufgenommen haben.
Keynes über „funktionslose Investoren“
Der vielleicht berühmteste Volkswirt, John Maynard Keynes, kritisierte die geschilderten leistungslosen oder Rentier-Einkommen schon 1936 in seiner wegweisenden „General Theory“ scharf: „I see, therefore, the rentier aspect of capitalism as a transitional phase (…) that the euthanasia of the rentier, of the functionless investor, will be nothing sudden (…) so that the functionless investor will no longer receive a bonus“.
Keynes sieht in dem Rentier-Kapitalismus keinen Sinn und bezeichnet Investoren, die Renten-Einkommen beziehen als „funktionslose Investoren“ („functionless investors“), also sinnlose Investoren, die keinen Beitrag zum Wohlergehen in der Ökonomie leisten. Solche funktionslosen Investoren müssten laut Keynes verschwinden, weil sie keinen ökonomischen Zweck erfüllen und nicht länger einen Bonus erhalten dürften.
Auf Keynes wird heute in den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in diesem Punkt nicht gehört. Die Wirtschaftswissenschaften sind längst fest in der Hand neo-liberaler Ökonomietheorien. Sie predigen ständig Gewinnmaximierung, leistungslose Einkommen, und Aktionärsfreundlichkeit – zu Gunsten der Reichen. Man schwört dort auf etwa sechs grundlegende weltanschauliche Axiome. Wer den Schwur nicht leistet, wird nicht Professor, ja bekommt nicht einmal einen Doktortitel. In den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten gibt es schon seit längerem keine wirkliche Wissenschaftsfreiheit mehr. Andere Meinungen kommen nicht mehr zu Wort und werden nicht mehr berufen.
Was tun?
Der erste, vielleicht wichtigste Schritt ist, die unschönen, asozialen, gefährlichen Mechanismen, die unser heutiges Wirtschaftssystem durchziehen, zu erkennen. Eine Fülle von Maßnahmen zur Abhilfe der oben beschriebenen Entwicklungen findet sich in meinem Buch „Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft“. Was die Wohnungsnot und die hohen Mieten anlangt, gibt es eine ganze Reihe konkreter, vielversprechender Vorschläge:
- Man könnte ein neu, „smart“ ausgestaltetes, konzeptionell weiterentwickeltes kommunales Erbbaurecht einführen beziehungsweise wiederbeleben. Auf diese Weise könnten Wohnungsbestände in die Sozialbindung zurückgeholt werden.
- Man könnte neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen oder die Gemeinwohlwohnungen ausbauen.
- Man könnte ein Vorkaufsrecht für Kommunen bei zum Verkauf angebotenen Immobilien zu einem unter dem Marktpreis liegenden Wert einführen. Im Anschluss könnten diese Liegenschaften auf Erbpachtbasis an private Nutzer oder Gewerbetreibende für 99 Jahre vergeben werden.
- Man könnte Genossenschaften im Wohnbereich nach dem Vorbild der Raiffeisengenossenschaften fördern und vermehren.
- Man könnte eine progressive Abgabe auf Bodeneigentum, das nicht selbst genutzt wird, einführen. Nach Berücksichtigung eines Freibetrages von vielleicht zwei oder drei Millionen Euro für Bodeneigentum pro natürlichem Mensch wird alles nicht selbst genutzte Bodeneigentum mit einer immer weiter steigenden Bodenwertsteuer belegt. Besonders gut mit dem Thema vertraut ist die Initiative „Grundsteuer zeitgemäß“. Dort findet man gute Konzepte, die man wunderbar umsetzen könnte. Das könnte einen Bau-Boom auslösen und die Wohnungsnot dauerhaft lösen.
Um die gefährliche Schuldenproblematik anzugehen, schlug die konservative Unternehmensberatung Boston Consulting Group 2011 einen Schuldenschnitt von etwa 25 Prozent, gapaart mit einer einmaligen Vermögensabgabe in gleicher Höhe vor. Der ebenfalls sehr konservative internationale Währungsfonds (IWF) forderte 2013 einen Schuldenschnitt in Höhe von 10 Prozent, gepaart mit einer Vermögensabgabe in gleicher Höhe.
Um die strukturelle Ungleichverteilung anzugehen, könnte man eine Erhöhung der Erbschaftssteuer anpacken. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 200 bis 400 Milliarden Euro vererbt, davon ein Großteil durch das wohlhabendste eine Prozent der Bevölkerung. Die real bezahlte Erbschafts- und Schenkungssteuer betrug in den letzten drei Jahren etwas über 11 Milliarden Euro, sie lag also real bei etwa 2 bis 5 Prozent des vererbten Vermögens. Das ist nicht gerade viel. Man sollte das meines Erachtens anheben, aber so, dass die mittelständischen Unternehmen nicht belastet werden. Am besten setzt man beim großen Grundbesitz an, der kann nicht ins Ausland fliehen. Der hiesige sehr niedrige Erbschaftssteuersatz zementiert und verstärkt die Ungleichverteilung und die Chancen-Ungleichheit bei Geburt.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 108.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 108.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: