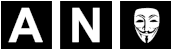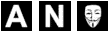Ja, auch ich bin ein besorgter Vater, und es ist meine Tochter, deren zweiter Anruf mich jetzt um 19.30 Uhr erreicht: „Kannst du mich bitte doch vom Bahnhof abholen? Hier ist so ein komischer Typ …“ Ich schnappe meine Jacke und sprinte los.
von Oliver Zimski
Die junge Frau besucht am frühen Abend ihre Eltern, fährt dazu mit der S-Bahn aus der Berliner Innenstadt in einen Außenbezirk. Erster Anruf gegen 19 Uhr: „Hallo Papa, kannst du kurz dranbleiben?“ „Klar, bist du vor dem Bahnhof?“ Er kennt das schon, der Vater. Der Vorplatz des Ringbahnhofs, in dessen Nähe seine Tochter wohnt, wird allabendlich von meist osteuropäischen Trinkern bevölkert, die dort krakeelen und sich volllaufen lassen. Den Bahnsteig erreicht man nur über einen Hindernisparcours von Glasscherben zerschlagener Flaschen, Müll und klebrigen Flüssigkeitslachen, immer in Gefahr, angepöbelt zu werden. Seine Tochter ist anmutig, zierlich, fein, kleidet sich gern elegant. Aber den Bahnhofsvorplatz überquert sie stets eiligen Schrittes, mit einer großen Basecap, die ihre langen Haare verdeckt, eine Hand in der Handtasche an ihrem Tierabwehrspray, die andere mit dem Handy am Ohr, um nach außen hin zu signalisieren: Ich bin eigentlich gar nicht hier, sondern ganz woanders, und wenn du mich trotzdem belästigst, kann ich ganz schnell Hilfe rufen!
„In der S-Bahn habe ich gelernt, meiner Intuition zu vertrauen“, sagt die junge Frau. Sobald sich einer in ihrer Nähe seltsam verhält, wechselt sie den Platz oder sogar den Wagen. Und sie sucht sich grundsätzlich Sitzplätze mit Wand oder Glasscheibe im Rücken. Warum das? „Weil mir die Bilder von der Ukrainerin in den USA nicht mehr aus dem Kopf gehen!“ Neulich allerdings nützte ihr auch alle Intuition nichts, als sie – wiederum an einem frühen Abend – von Mitte nach Charlottenburg fuhr. Im ersten Wagen lief ein „Schizo“ auf und ab, der aggressiv herumbrüllte. Die wenigen anderen Fahrgäste duckten sich weg.
Am nächsten Bahnhof wechselte die Tochter in den Nachbarwagen und fand zu ihrer Freude eine Bank für sich allein. Das rote Lämpchen leuchtete schon auf, da zwängte sich eine vermummte Gestalt durch die Tür und setzte sich ihr direkt gegenüber, die Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass man keine Haut sah. Als die Gestalt ihre Kleidung zu lüften begann, breitete sich sofort ein erbärmlicher Gestank aus. Wieder stand die junge Frau auf und ging zur Tür, um dort von einem betrunkenen Penner angequatscht zu werden: „Du, haste bisschen Kleingeld für mich? Wieso denn nicht? Hey, nur einen Euro!“ In der ersten Tür des dritten Wagens saßen zwei Besoffene auf dem Boden, und vom anderen Ende her näherte sich ein weiterer aggressiver Schreihals. „Diese S-Bahn-Fahrt war wirklich krass“, sagte die Tochter zu mir. „Wie im Zombiefilm!“
„Berlin ist hart, aber herzlich“
Ja, der besorgte Vater bin ich selbst, und es ist meine Tochter, deren zweiter Anruf mich jetzt um 19.30 Uhr erreicht: „Kannst du mich bitte doch vom Bahnhof abholen? Hier ist so ein komischer Typ …“ Ich schnappe meine Jacke und sprinte los. Fünf Minuten später stehe ich am Bahnsteig neben der gerade eingefahrenen S-Bahn. „Danke, Papa!“, sagt die Tochter. „Wen meintest du?“, frage ich und lasse meinen Blick über den Strom der Ausgestiegenen schweifen. „Er ist schon weg“, erwidert sie. Ein Schwarzer war es, der zwanzig Minuten lang den Blick nicht von ihr ließ, zweimal mit ihr umstieg und ihr auch folgte, als sie – gemäß ihrer Intuition – den Wagen wechselte.
Diskussionen über Einwanderungspolitik interessieren meine Tochter nicht, auch wenn problematische Männergruppen nach ihrer 23-jährigen Lebenserfahrung meist solche mit einschlägigem Migrationshintergrund sind. Betrunkene Deutsche oder Polen sind ihr ebenso zuwider wie die Anmache türkisch-arabischer Talahons. Sie interessiert, abends heil von A nach B zu kommen, und das gilt auch für die meisten ihrer Freundinnen, wie sie sagt. Sind die nachts allein unterwegs, dann nur mit Uber, gesponsert von den Eltern.
In den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe tönt seit neuestem die folgende gutgemeinte Ansage vom Band, auf Deutsch und Englisch: „Berlin ist hart, aber herzlich. Bitte zeigt Respekt und seid nett zueinander!“ Diese Botschaft ist ebenso hilf- und wertlos wie die immergleichen Beteuerungen von Politikern nach islamistischen Anschlägen, so etwas habe keinen Platz in unserer Gesellschaft, wir ließen uns nicht spalten.
In einer Gesellschaft, die längst in unzählige Parallelgesellschaften aufgespalten ist und sich selbst immer fremder wird, gibt es kein „Wir“ mehr. Daran hat die seit zehn Jahren andauernde ungeregelte Masseneinwanderung in die deutschen Sozialsysteme einen gehörigen Anteil. Der öffentliche Raum ist längst zum Angstraum geworden, besonders für junge Frauen. Die müssen selbst sehen, wie sie damit klarkommen. Oder um es mit einem abgewandelten Zitat unserer ehemaligen Kanzlerin zu sagen: Das ist jetzt eben nun mal so!
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: