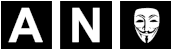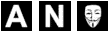In Mailand war noch kein einziger Wettkampf bestritten, da sorgte die deutsche Olympia-Mannschaft weltweit schon wieder für Spott und Hohn. Mit Anglerhut, Poncho und „Team D“-Schriftzug gab man sich bei der Eröffnungsfeier der Lächerlichkeit preis.
von Thomas Hartung
Olympische Eröffnungsfeiern sind längst keine naive Folkloreparade mehr, sondern eine globale Bühne der Selbstrepräsentation. In wenigen Sekunden verdichtet sich, was eine Nation von sich zu zeigen wagt: Stoff, Farbe, Form. Dass ausgerechnet der Auftritt der deutschen Athleten in Mailand als „Team D“ nun als “Demontage”, “Demütigung“, “Entwürdigung”, ja “offene Sabotage des eigenen Images” diskutiert wird, ist deshalb mehr als nur eine Randnotiz der Sportberichterstattung. „Deutschland glänzt mittlerweile in fast allen Bereichen nur noch mit Zweit- und Drittklassigkeit. Und jetzt muss man sich als Deutscher auch noch für das Outfit der deutschen Olympiasportler schämen“, lautet ein Kommentar auf X. Ein anderer User schreibt: „Was geht da mit dem Deutschen Olympia Outfit? Wusste gar nicht, dass Angeln jetzt olympisch ist?! Euer Ernst, adidas?“. „Was ist das denn? Wollen Sie mit Ihren Ponchos Peru darstellen? Viele Länder haben wunderschöne Ski-Anzüge und wir hängen uns Decken um“, schreibt ein anderer Nutzer auf Instagram, manche mutmaßen gar Kaftans.
Maria-Antonia Gerstmeyer fasst das in der “Welt” treffend in folgender Passage: „Was ein Land seinen Athleten anzieht, erzählt mehr über Ehrgeiz, Selbstbild und Anspruch als jede Medaillenbilanz … Das modische Bild, das Deutschland bei den Olympischen Winterspielen abgibt, ist ein Desaster. Und das ausgerechnet in Mailand.“ Damit ist der Maßstab gesetzt: Es geht nicht um Geschmack, sondern um Selbstbild. Schaut man sich das Arsenal der letzten Jahre an – vom „Mannschaft“-Trikot bis zu den aktuellen Olympia-Ponchos –, erkennt man eine wiederkehrende Figur: Sportswear im globalen Corporate-Stil, technisch ausgefeilt, modisch austauschbar, mit ein paar Pflichtzitaten in Schwarz-Rot-Gold. Nationalität ist eine Farbkombination, kein Stoff. Der Athlet trägt keinen „Nationalanzug“, sondern einen Markenartikel, der in ähnlicher Form auch den Teams anderer Länder übergestreift wird.
Adidas und die Ästhetik der Entnationalisierung
Adidas ist dabei nicht bloßer Dienstleister, sondern ästhetischer Gatekeeper. Wer ein Dutzend Nationen ausrüstet, denkt in Serien, nicht in Singularitäten. Individualität wird in ein Serienprodukt übersetzt, das tausendfach vom Band läuft. Die eigentliche Bildsprache bleibt die des globalen Sportkapitalismus: Polyester, Performance, Pastell.
Schnitte, Materialien, Silhouetten folgen einer einheitlichen Markensprache; Unterschiede werden nachträglich über Logos und Farbbalken eingefügt. Aus Sicht des Konzerns ist das rational. Aus Sicht einer politischen Gemeinschaft hat es eine klare Botschaft: Die eigentliche Identität des Trägers ist nicht die Nation, sondern die Marke.
Während andere Länder ihre Athleten mit Outfits ins Stadion schicken, die Stolz, Würde und Eigenart ausstrahlen, wirken die Deutschen wie Statisten im falschen Film – verhüllt in unförmigen Polyesterflächen und Anglerhütchen – von manchen als „Bademantel mit Fischerhut“ verhöhnt, vom Designer Harald Glööckler als „so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen“ in der “Bunte” abqualifiziert.
Spitzensportler – also jene Menschen, die Disziplin, Leistung und Durchhaltevermögen verkörpern – werden optisch in etwas verwandelt, das zwischen Fun-Event und Karneval schwankt. Man kann das großzügig als „Designfehler“ abtun. Man kann es aber auch ernster nehmen: Wenn Nationen ihren Besten Kleidung geben, die sie kleiner, lächerlicher, konturloser erschei-nen lässt als sie sind, sagt das etwas über die Selbstachtung dieser Nation – und über ihre Angst, sich in Form zu bringen. Man könnte sagen: Die Outfits des deutschen Teams verkörpern nicht in erster Linie Deutschland, sondern die Bundesrepublik als postnationale Verwaltungseinheit. Kein Motiv, keine Silhouette, kein Detail verweist auf konkrete historische Formen – kein Bezug zu regionalen Trachten, zu Handwerk, zu Kulturraum. Man sieht nicht, aus welchem Land diese Sportler stammen; man sieht, aus welchem Konzern.
Von der Panne zur Methode
Das ist kein Zufall, sondern die Fortsetzung einer politischen Erzählung mit ästhetischen Mitteln. Die Bundesrepublik versteht sich seit Jahrzehnten als „geläuterte“, posthistorische Nation – als Rechtsraum, Wertegemeinschaft, Exportmaschine. Das Kleid der Olympioniken ist die textile Verlängerung dieses Selbstbilds: möglichst wenig Anknüpfung an „verdächtige“ historische Symbolik, maximale Kompatibilität mit einer Welt, in der jeder zu jedem gehören soll. Wir sehen hier kein einmaliges Verrutschen der Geschmacksskala, sondern ein Muster: dieselbe Ästhetik der Selbstverkleinerung beim DFB-Branding der „La Mannschaft“, dieselbe Scheu vor Form in vielen nationalen Auftritten, dieselbe Mischung aus Ironie und Funktionsnebel. Man kann, ohne in Verschwörungsdenken zu verfallen, feststellen: Diese Häufung ist kein reiner Zufall. Sie passt zu einer politischen Kultur, die das Nationale systematisch entkernt und nur noch als Restgröße toleriert: Flagge ja, aber bitte nur als Designzitat; Geschichte ja, aber nur als Schuldnarrativ; Gemeinsamkeit ja, aber nur als abstrakte „Wertegemeinschaft“.
In solch einem Klima liegt es nahe, auch die ästhetische Repräsentation auf maximale Unverbindlichkeit zu trimmen. So besehen erscheinen die Outfits nicht als Ausrutscher, sondern als Symptom. Die Athleten werden nicht in erster Linie als Repräsentanten einer Nation gesehen, sondern als Träger eines normierten Imagepakets: divers, harmlos, ironisch. Dass sie damit global zur Zielscheibe des Spottes werden, ist offenbar einkalkuliert. Die Lächerlichkeit trifft nicht den Designer, sondern den Körper, der darin steckt – den deutschen Spitzensport. Wer das als „kalkulierte Demontage“ bezeichnet, formuliert zugespitzt, aber berührt etwas Reales: Indem man gerade diejenigen, die am sichtbarsten nationale Leistungsfähigkeit verkörpern, optisch herunterzieht, sendet man ein Signal gegen jeden Rest von kollektivem Selbstbewusstsein. Man muss diese Strategie nicht als Masterplan einer Zentrale denken; es reicht, sie als Reflex eines Milieus zu verstehen, das jede klare, stolze Form für potenziell gefährlich hält – und sie darum ins Lächerliche zieht.
Die Mongolei: Form statt Verlegenheit
Der Kontrast zur mongolischen Delegation macht das besonders deutlich. Dort treten die Athleten in modernisierten traditionellen Trachten auf: lange Roben, bestickte Westen, klare, kräftige Farben, Motive, die unübersehbar aus einem bestimmten Kulturraum stammen. Man sah die 20 Stunden Handarbeit, die in jeder Robe steckten, man sah Stolz, sah eine Form, die mehr erzählt als jede PR-Phrase. Die Reaktion im Netz war einmütig: „Gold im Outfit“, „So geht Identität“. Und das nicht nur von Konservativen oder Traditionalisten; auch urbane Modeportale, die sonst jeden Hauch von „Nation“ mit Argwohn kommentieren, waren begeistert. Offenbar ist die Sehnsucht nach Form nicht verschwunden – sie findet nur kein Ventil mehr im eigenen Land. Während über das deutsche Outfit gestritten, gewitzelt, gegrantelt wurde, war bei den Mongolen eine seltene Einhelligkeit zu spüren: Hier stimmt etwas.
Man sah nicht nur Mode, man sah Form – eine Verdichtung von Geschichte, Klima, Lebenswei-se. Gerade die Kombination von Tradition und zeitgenössischem Design wirkte attraktiv. Mit anderen Worten: Es ist nicht so, dass „die Jugend“ per se nichts mit Tracht anfangen könnte. Sie reagiert im Gegenteil positiv, wenn Formensprache und Selbstbewusstsein zusammenfinden. Während die Mongolei ihre Steppen- und Nomadenkultur ernst nimmt und in die textile Gegen-wart übersetzt, macht Deutschland aus seiner Geschichte eine Sicherheitslücke, die man bes-ser mit Kunstfasern verklebt. Vor diesem Hintergrund wirkt der deutsche Auftritt nicht nur modisch blass, sondern kulturell verarmt. Wo die Mongolei sich traut, ihre Steppen- und Reiterkultur in Stoff zu gießen, bleibt Deutschland bei abstrakten Farbbalken. Wo andere Nationen mit Hüten, Stickereien, traditionellen Schnitten spielen, trägt Team D Unisex-Sportswear. Wo andere zeigen wollen, „wer wir sind“, dominiert hier die Angst, „wie wir wirken könnten“. Das Ergebnis sind Outfits, die aussehen, als seien sie extra so gestaltet worden, dass sich niemand in ihnen zu wohl fühlen soll.
Netzdebatte als Symptom einer tieferen Verunsicherung
Die Wucht der Debatte in den sozialen Medien ist deshalb kein reines „Modegewitter“. Wenn Kommentatoren schreiben, die Athleten würden „der Lächerlichkeit preisgegeben“ oder man habe sie „vor der Welt entwürdigt“, dann übertreiben sie rhetorisch – treffen aber die darunter-liegende Kränkung. Wer im Leistungssport groß wird, lebt vom Ernst: Training, Disziplin, Konkurrenz. Wenn dieser Ernst in der Kleidung bewusst gebrochen wird, entsteht ein Riss zwischen dem, was der Körper leistet, und dem, was ihm die Nation zugesteht, zu sein. Die politisch-kulturelle Frage lautet: Warum ist ausgerechnet hier keine Würde mehr erwünscht? Warum möchte ein Land, das ansonsten beständig über „Respekt“ und „Anerkennung“ redet, ausgerechnet auf der größten Bühne der Welt seine eigenen Besten in eine Art ironische Tarnung stecken?
Eine plausible Antwort lautet: Weil Würde Form braucht, und Form als Gefahr gilt. Wer Athleten wie „Helden“ erscheinen lässt, könnte damit ein falsches Pathos wecken. Also dimmt man alles herunter: Farben, Schnitte, Ernst. Der Sportler soll nicht als Figur der Identifikation auftreten, sondern als austauschbarer Teil einer anonymen „Delegation“: damit haben linke Gleichmacherphantasien auch Olympia gekapert. Andere westliche Länder zeigen, dass es auch anders geht: Frankreich, Italien, selbst Großbritannien spielen immer wieder mit Anklängen an historische Silhouetten, Farben, Motive. Sie zeigen Tweed, Blazer, Matrosenkragen, sie zitieren ihre Modegeschichte. Deutschland dagegen tilgt jede Spur von Lederhose, Dirndl, Schützenhut – als sei schon das textile Anknüpfen an Herkunft ein Risiko.
Zweckgemeinschaft statt Kulturnation
Hier zeigt sich ein spezifisch deutscher Selbstverdacht: Das Nationale gilt als kontaminiert, also wird es in die Unverbindlichkeit des Sportartikels ausgelagert. Die Flagge darf noch als Farbverlauf existieren, alles andere wäre „zu viel“. Adidas ist dadurch nicht nur Ausrüster, son-dern auch Waschmaschine: Die kleinteiligen Bilder von Region und Geschichte werden in einem globalen Designprogramm aufgelöst. Die Online-Diskussion über die deutschen Outfits ist deswegen so heftig, weil sie eine tiefer liegende Unzufriedenheit berührt. Wenn Nutzer fragen, warum man beim wichtigsten Nations-auftritt der Welt „wie eine H&M-Laufgruppe“ aussehe, dann ist das mehr als Modekritik. Es ist die Ahnung, dass hier eine Repräsentationslücke klafft. Dass ein Land, das sich permanent selbst pädagogisiert, dekarbonisiert und diversifiziert, an dem Punkt sprachlos wird, an dem es einfach zeigen müsste, wer es ist.
Die Empörung über Poncho und Anglerhut hat etwas Überdrehtes, weil sie stellvertretend vieles anderes verhandelt: die allgegenwärtige Ästhetik der Entwertung, in der alles so aussehen soll, als dürfe man es nicht zu ernst nehmen; die Angst, mit „zu viel Deutschland“ irgendwo anzuecken; das Gefühl, dass man sich international am liebsten als sympathische Zweckgemeinschaft zeigen möchte, nicht als Kulturnation.
Gravität statt Geschmackspolizei
Eine konservative Kritik läuft daher nicht auf Geschmackspolizei hinaus, sondern auf eine ande-re Grundfrage: Traut sich eine Nation, ihren Repräsentanten Schönheit, Stolz, Gravität zuzuge-stehen? Oder behandelt sie sie wie wandelnde Werbeträger, die funktional korrekt, aber symbolisch harmlos verpackt werden müssen? Die Antwort, die Deutschland derzeit gibt, ist eindeutig. Die alternative Antwort ist nicht schwer zu skizzieren: weg von der fast vollständigen Abhängigkeit von einem einzelnen Sportartikelkonzern; hin zu einem Prozess, in dem Kultur, Region, Geschichte und Sport gemeinsam eine neue Silhouette suchen. Nicht Dirndl und Lederhose auf dem Eis, aber auch nicht Poncho und Anglerhut in Mailand. Ein Land wie Deutschland verfügt über eine Fülle von Formenschätzen: regionalen Trachten, Handwerk, Mustern, Farben, Motiven – vom Schwarzwald bis zur Lausitz, von Friesenjacke bis Bergmannsuniform. Bayrisches Glas, erzgebirgische Holzkunst, schwäbische Autos… Daraus ließe sich, wenn man wollte, eine moderne, prägnante, unverwechselbare Olympia-Silhouette entwickeln: reduziert, aber anknüpfungsfähig.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: