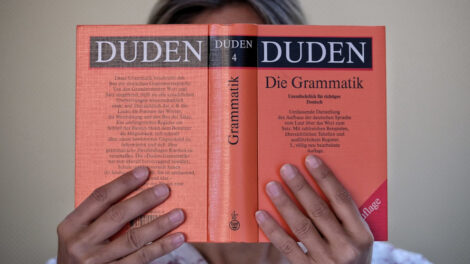Kommerz und Propaganda im Stadion. Deutschlands Volkssport Nummer eins wird in die Zange genommen: einerseits durch eine immer hemmungslosere Kommerzialisierung, andererseits durch staatliche Politisierung. Wenn nicht umgesteuert wird, bleiben die Fans bald weg.
von Sven Reuth
Es sollte ein entspannter Provinzkick werden – am letzten Julisamstag im österreichischen Altach: Im Rahmen der Saisonvorbereitung traf Borussia Dortmund in der Cashpoint-Arena auf den italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Doch es regnete Bindfäden. Um die Zuschauer im Vereinskanal BVB-TV bei Laune zu halten, machten die beiden Moderatoren Klamauk: Der langjährige Stadionsprecher Norbert Dickel, eine Klublegende der Westfalen, sprach mit Blick auf die Kontrahenten flapsig von «Itakern», wobei er anfügte, dass dies für ihn «keine Beleidigung» sei und er «alle Italiener» möge.
Patrick Owomoyela wird an den Hitler-Pranger gestellt.
Mitkommentator Patrick Owomoyela, einer der ersten dunkelhäutigen Nationalspieler im DFB-Dress, wollte noch einen draufsetzen und ließ sich als schnarrender Hitler-Imitator über die «Wasserschlacht von Altach» aus – ein harmloser Spaß, wie man ihn so ähnlich gefühlt hundertfach von Entertainer Harald Schmidt kennt. Auch wenn man diese Art des Humors nicht teilt, muss man die Reaktionen darauf befremdlich finden: Der Mainstream echauffierte sich, als sei Deutschland noch mal in Polen einmarschiert, die Bild-Zeitung nudelte das Gealber sogar zu einem «Hitler-Skandal» hoch. Der Verein reagierte betroffen und verkündete eine «Denkpause» für das beliebte Moderatorenduo, das gerade wegen seines nicht immer bierernsten Auftretens als besonders kultig gilt. Jeder halbwegs normale Mensch aber fragte sich: Welche gesellschaftliche Stimmung herrscht in diesem Land, wenn eine harmlose Blödelei zur Staatsaffäre hochgepusht wird?
Das Fanal von Mölln
Galt nicht die totale Politisierung des Sports früher als untrügliches Zeichen autoritärer oder gar totalitärer Staaten? Fährt Deutschland auch hier auf abschüssiger Bahn? Ein Rückblick: Sogar während der Zeit des Kalten Krieges war der Fußball politfreie Zone – es ging ausschließlich um den Sport. Zu einer ersten politischen Manifestation kam es vor 27 Jahren. Bei einem Brandanschlag in der holsteinischen Kleinstadt Mölln kamen drei türkischstämmige Personen, darunter zwei Kinder, ums Leben. Die ermittelnden Behörden und die Justiz standen unter enormem Druck, ein Zeichen gegen den erstarkenden Rechtsextremismus im wiedervereinigten Deutschland zu setzen. Am Ende wurden ein Jugendlicher und ein junger Mann verurteilt, obwohl erhebliche Zweifel an ihrer Täterschaft bestanden. In der Rückschau stellte selbst die Schleswig-Holsteinische Zeitung die Frage, «ob die Ahndung der Verbrechen in Mölln 1992 nicht geradezu nach bewusst handelnden, politisch motivierten und hartnäckig leugnenden Tätern verlangte und ernsthafte Zweifel daran nicht aufkommen ließ».
Die Reaktionen auf die feige und durch nichts zu rechtfertigende Tat schossen übers Ziel hinaus: In ganz Deutschland bildeten die Menschen Lichterketten, allein in München sollen sich 400.000 Personen beteiligt haben. Am dritten Advent jenes Jahres liefen die Spieler aller 18 Erstligavereine mit Trikots auf, die statt des üblichen Sponsoren-Aufdrucks den Slogan «Mein Freund ist Ausländer» trugen und dabei von Migrantenkindern aufs Spielfeld begleitet wurden. «Die Fußballer wollen, können und dürfen keine Politik machen», hatte der damalige DFB-Präsident Egidius Braun noch kurz zuvor betont. Doch das erwies sich schon bald als Makulatur. Die Politisierung des deutschen Fußballs setzte sich unvermindert fort.
Bosman öffnet die Schleusen
Eine weitere Zäsur war die Einführung einer neuen Stadionordnung durch den Zweitligisten FC St. Pauli im Jahr 1993: Man verbot, «Kleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, deren Herstellung, Vertrieb oder Zielgruppe nach allgemein anerkannter Ansicht im rechtsextremen Feld anzusiedeln sind». Das Beispiel machte Schule – und es war kein Zufall, dass die Hanseaten Avantgarde spielten. Zwar hat der Kiezklub nicht ansatzweise eine linke Tradition vorzuweisen und müsste sogar als historisch belastet gelten, da der frühere SS-Standartenführer und Hamburger NSDAP-Gauwirtschaftsführer Otto Wolff auch nach 1945 eine wichtige Rolle im Verein spielte und mit dessen goldener Ehrennadel ausgezeichnet worden war. Doch seit etwa 1990 ist das Millerntor Tummelplatz von Linksextremisten, die ursprünglich aus dem Umfeld der Hausbesetzerszene rund um die Hafenstraße kamen. Und diese gaben eine neue Agenda vor: Antifaschismus wurde zunehmend schick, nicht nur, aber zunehmend auch in den Fußballstadien. Im Grunde war das aber nur aufgesetzt und politischer Kleister, mit dem verdeckt werden sollte, dass der Fußball sich längst auf dem Weg zur totalen Kommerzialisierung befand.
Als der Europäische Gerichtshof dann im Dezember 1995 nach einem von dem belgischen Spieler Jean-Marc Bosman angestrebten Musterprozess entschied, dass die Freizügigkeitsklausel des Vertrags der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auch auf den Fußballbetrieb anzuwenden sei, war die Multikulti-Lawine nicht mehr aufzuhalten: Im Herbst 2001 schickte Energie Cottbus im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München eine Mannschaft auf den Platz, in der kein Spieler mehr einen deutschen Pass besaß. Und 2004 setzte der belgische Verein KSK Beveren in einem UEFA-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart zehn Kicker von der Elfenbeinküste ein.
Diese Entwicklung sollte auch vor der Nationalmannschaft nicht haltmachen. Der Druck, unbedingt auf möglichst viele Spieler mit Migrationshintergrund zu setzen, verstärkte sich nach dem WM-Triumph Frankreichs 1998, der mit einer bunt gemischten Truppe errungen worden war. Grünen-Politiker wie Cem Özdemir oder Daniel Cohn-Bendit forderten fast schon im Befehlston die Aufstellung einer ethnisch vielfältigen Nationalmannschaft. Der DFB wäre dem wohl auf der Stelle nachgekommen, hätten sich nicht die talentiertesten türkischstämmigen Spieler, die in Deutschland geboren wurden, lange Zeit allen Avancen verweigert.
Afro-Tönnies
Im Sommer dieses Jahres kam es zu einem Sturm im Wasserglas, nachdem der Fleischfabrikant Clemens Tönnies, seit 2001 Aufsichtsratsvorsitzender des Bundesligisten Schalke 04, beim Tag des Handwerks in Paderborn in einem frei gehaltenen Vortrag verschiedene Überlegungen zum Thema Klimawandel geäußert und dabei mit Blick auf Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) gesagt hatte: «Der spendiert dann jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika. Dann hören die auf, die Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn‘s dunkel ist, wenn wir die nämlich elektrifizieren, Kinder zu produzieren.» Die Aussage löste einen bundesweiten Sturm der Empörung aus und zog Rücktrittsforderungen nach sich. Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung, Günter Nooke (CDU), bewahrte hingegen einen kühlen Kopf und meinte, dass man über die von Tönnies angesprochenen «realen Probleme» diskutieren müsse.
Der Gelsenkirchener Hamit Altintop, der es auf 84 Länderspiele im Trikot mit dem roten Halbmond bringen sollte, äußerte beispielsweise klipp und klar: «Meine Mama kommt aus der Türkei, mein Vater kommt aus der Türkei, ich bin Türke.» Fast wortgleich klang die Absage des vom DFB besonders heftig umworbenen Lüdenscheiders Nuri Sahin: «Man muss sich wohlfühlen. (…) Meine Eltern und meine Familie sind türkisch, deshalb fühle ich mich als Türke.» Als der damals erst 18 Jahre alte Mesut Özil am 11. Februar 2009 bei einem Freundschaftsspiel gegen Norwegen sein deutsches Länderspieldebüt gab, waren die DFB-Oberen aus dem Häuschen. Dabei hatte der Spross einer Gastarbeiterfamilie, der damals für den SV Werder Bremen kickte, von Anfang an ein rein funktionales Verhältnis zu unserer Nationalmannschaft. In seiner 2017 erschienenen Autobiografie Die Magie des Spiels schrieb er zu seiner Entscheidung für die DFB-Elf kühl: «Für mich war es keine emotionale Sache. Es schien mir einfach notwendig, um meinem Lebenstraum vom Spitzenfußballer näherzukommen.»
Özils falsches Spiel
Es war deshalb ein schwerer Fehler von Funktionären, Medien und Politik, den Gelsenkirchener zu einem Botschafter – wider Willen – zu machen. Weder die Verleihung des Integrations-Bambis noch Merkel-Besuche in der Kabine konnten etwas daran ändern, dass er im Herzen offenbar immer Türke blieb. So war es in gewisser Weise folgerichtig, dass er im vergangenen Jahr mit einem großen Knall aus der Nationalmannschaft ausschied – wobei er es sich nicht verkneifen konnte, medienwirksam Rassismusvorwürfe gegen Deutschland zu erheben. Tatsächlich optimierte er, der in der muslimischen Welt zum prominentesten Sportler aufgestiegen ist, damit bloß sein eigenes Markenprofil.
«Meine Mama kommt aus der Türkei, mein Vater kommt aus der Türkei, ich bin Türke.» Hamit Altintop
Bei der überwiegenden Mehrzahl der 23 Millionen Follower von Özil auf Twitter kommt es deshalb besser an, wenn der heutige Star des FC Arsenal von der Pilgerfahrt nach Mekka statt aus der Kabine der DFB-Elf postet. Sein Werdegang ist darum eher ein Beispiel für die totale Kommerzialisierung dieses Sports als für die angeblichen Rassismusprobleme, die man dem DFB von politisch interessierter Seite ohnehin bis in alle Ewigkeit andichten wird.
Bei den deutschen Fans beginnt sich inzwischen ein Umschwung abzuzeichnen: Immer mehr von ihnen kehren dem hochklassigen Fußball den Rücken und wandern in die unteren Ligen ab. Für viele sind die Regionalligen und die 3. Liga zu Refugien geworden, die sich nicht im fatalen Zangengriff von Kommerz und Politik befinden. Den deutschen Fußballfunktionären ist zu wünschen, dass sie zur Vernunft kommen, bevor noch ein Massenexodus der Zuschauer einsetzt.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: