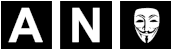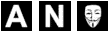Frauen werden auf offener Straße verfolgt, begrapscht und vergewaltigt. Überall herrschen Verwahrlosung und Gewalt – das ist das „Stadtbild“ in immer mehr deutschen Städten. Doch wer die Zustände anspricht, wird als „Rassist“ abgestempelt. Diese Realitätsverweigerung ist Kalkül. Sie hält genau jene Zustände aufrecht, über die niemand sprechen soll.
von Pauline Schwarz
„Bleib stehen. Ey, bleib stehen, ich will dich doch nur ficken, du Schlampe“ – schrie ein junger Araber vor einiger Zeit, während er mich im Dunkeln verfolgte. Er ließ sich nicht davon abhalten, dass ich schneller ging. Auch nicht davon, dass ich nicht reagierte. Er griff nach meinem Arm, wollte mich festhalten – und lachte, als er mein erschrockenes Gesicht sah. Erst als Passanten auf die Szene aufmerksam wurden, ließ er von mir ab. Während er wegging, trat er noch gegen ein Fahrrad und schimpfte laut hörbar über die kleine „Nutte“, die sich ihm nicht ergeben wollte.
Was ich gerade beschrieben habe, ist nur eine von unzähligen Erfahrungen mit dem Berliner „Stadtbild“, die ich seit meiner Kindheit machen durfte – wobei das noch einer der harmlosesten Zusammenstöße mit dem ist, was die Grünen-Chefin Franziska Brantner so gerne kollektiv als „Vielfalt“ bezeichnet. Sie und ihre Partei wollen sich überhaupt nicht mit den Zuständen auf den deutschen Straßen auseinandersetzen, wollen überhaupt nicht begreifen, was Friedrich Merz meint, wenn er nach Rassismus-Vorwürfen entgegnet: „Fragen Sie mal Ihre Töchter“.
„Irgendwelche Töchter“ interessieren Frau Brantner jedoch nicht – das hat sie in einem Pressestatement am Montag klargestellt. Es war beachtlich abfällig für eine Frau, die gegenüber der Bunten über sich sagte: „Ich bin gerne Mama“ – und zwar Mama einer Tochter, die gerade einmal 14 oder 15 Jahre alt ist. Für mich war das das Alter, in dem ich so richtig zu spüren bekam, dass sich der Kiez, in dem ich aufgewachsen bin – das „Stadtbild“ – verändert hatte. Wobei die Angst, die Friedrich Merz mit seinem Statement ansprechen wollte, schon ein paar Jahre früher einsetzte. Ich kannte sie nicht erst als Teenager, sondern schon als Kind.
Etwa als ich zehn Jahre alt war, merkte ich das erste Mal, dass sich der Park und die Straßen vor unserer Haustür veränderten. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal einen afrikanischen Mann durch die Straßen rennen sah – dicht gefolgt von sechs Polizisten. Damals dachte ich in meiner kindlichen Naivität noch: Was soll das? Ich kannte Afrikaner nur als Nachbarn, Freunde, als Familie. Doch das änderte sich innerhalb von Monaten. Als meine anderthalb Jahre ältere Schwester das erste Mal weinend nach Hause kam, weil sie in dem Park, in dem wir als Kinder so gerne gespielt hatten, von mehreren Männern festgehalten und begrapscht wurde.
Kurz danach landete ich selbst im Schwitzkasten von einem der afrikanischen Männer, die plötzlich in jeder Ecke und an jedem Ausgang des heute berüchtigten Görlitzer Parks standen. Dass ich elf oder zwölf Jahre alt war, hielt ihn nicht davon ab, meinen Kopf zwischen seinem Oberkörper und Arm einzuklemmen und mich über hunderte Meter wie ein Tier durch die Manege zu führen. Es ist jetzt fast zwanzig Jahre her, aber ich habe immer noch sein lächelndes Gesicht vor Augen. Ich weiß noch genau, wie er roch, während er auf mich einredete. Er fasste mich an, tat mir weh, trotzdem konnte ich weder weinen noch schreien – ich war in einer Art Schockstarre.
Seit diesem Tag traute ich mich nicht mehr in den Park, ich nahm lieber einen großen Umweg in Kauf, um von der Schule nach Hause zu kommen. Lange ging das aber nicht gut, denn das Elend und die Kriminalität aus dem Görli, in dem sich inzwischen auch immer mehr Obdachlose zu Hause fühlten, verlagerte sich zunehmend. Nach 2015 bekriegten sich arabische und afrikanische Drogendealer auf offener Straße, mitten in der Hauptstadt. Ich bin einmal selbst fast von einer Flasche getroffen worden, die eine verfeindete Gruppe auf eine andere warf, bevor sie mit Metallstangen aufeinander losgingen. Manchmal fielen auch Schüsse, einmal direkt neben einer Freundin von mir.
In den Ritzen des Kopfsteinpflasters gehörten Patronenhülsen bald genauso zum Alltag, wie das Graffiti an den Wänden, das mehr als einmal von Blut verfeinert wurde. Von unserer Haustür zogen sich mehrmals verschmierte Handabdrücke über die ganze Hauswand, manchmal noch feucht, manchmal bröselte das getrocknete Blut schon von der Wand. Als direkt vor meiner Grundschule ein Mann erschossen wurde, weil er „Jugendlichen“ – wie es damals hieß – kein Feuer geben wollte, schüttete man einfach Sägespäne über die Blutlache. Ich hatte wochenlang Albträume von einer Hand, die sich aus dem Häufchen reckte. Denn ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten.
Den wohl brutalsten Anblick in dieser Hinsicht erhaschte ich aber etwa zehn Minuten weiter, im Ost-Berliner Bezirk Treptow. An der Bushaltestelle der riesigen Kreuzung vor dem Bahnhof war der ganze Gehweg rot eingefärbt. Ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder so viel Blut auf einmal gesehen – tausende Spritzer und größere Lachen über eine Fläche von vielleicht 25 bis 30 Metern. Später erzählte die Mutter eines Freundes von mir, dass sie gesehen hatte, wie mehrere Araber einen Afrikaner dort malträtiert hatten. Wie sie immer und immer wieder auf ihn einschlugen, bis er sich nicht mehr bewegte – das war morgens, mitten im Berufsverkehr, aber nicht ein einziger Mensch traute sich, einzuschreiten.
Ich habe in Berlin generell die Erfahrung gemacht, dass Zivilcourage wegen der enormen Bedrohung für das eigene Leben zum Fremdwort geworden ist – aber wen wundert das? Wem will man das vorwerfen? Ein früherer Freund von mir wollte am Alexanderplatz einmal zwei Mädchen helfen, die von Männern auf der Straße belästigt wurden. Dafür rammten sie ihm ein Messer in den Arm – die riesige Narbe erstreckte sich auch Jahre später noch von seiner motorisch leicht eingeschränkten Hand bis hoch zum Oberarm. Damit muss man in einer Stadt, in der es laut LKA-Statistik zehn Messerangriffe pro Tag gibt, schlicht rechnen.
Also sieht man weg und versucht, möglichst unbeschadet den Spießrutenlauf zwischen ominösen Gestalten, Obdachlosen und dem ganzen Unrat zu überstehen, der das Stadtbild seit Jahren verschönert. Man versucht zu ignorieren, wenn jemand ungeniert neben das Auto kackt, in das man gerade einsteigen will. Und versucht, nicht zu ersticken, wenn man an den Lagern und Zeltstädten vorbeiläuft, die sich in der ganzen Stadt breitmachen. Denn bei vielen der Menschen, die von Kreuzberg bis nach Charlottenburg in den Hauseingängen oder in den U-Bahn-Waggons liegen, kann man die Verwesung und die Exkremente schon lange riechen, bevor man den Verursacher sehen kann.
Eine solche Gestalt, ein offensichtlich psychisch schwer kranker Mann, der hysterisch mit den Stimmen in seinem Kopf diskutierte, versuchte einmal, meine Autotür aufzureißen – die ich zum Glück kurz vorher verschlossen hatte, weil ich ihn kommen sah. Als er das bemerkte, rastete er völlig aus, schwafelte irgendwas von Verfolgern und trat immer wieder gegen meine Autotür, bevor er davonrannte. Ein anderes Mal saß ich abends mit Freunden auf einer Bank, als ein Mann, der mit sich selbst sprach, anfing, die Motorräder vor uns umzuschmeißen. Auf seinem Weg der Zerstörung wurden auch noch ein paar Fahrräder zu seinem Opfer. Wir sagten kein Wort, ein Pärchen machte aber den Fehler, eines der Räder wieder aufzustellen. Als der Mann das bemerkte, rannte er ihnen entgegen und bewarf sie mit Flaschen und Pflastersteinen.
Ich habe gesehen, wie ein Obdachloser absichtlich ein junges Mädchen die Treppe an einem U-Bahnhof heruntergestoßen hat. Wie ein Mann einer rumänischen Frau, die offensichtlich für ihn anschaffen war, auf offener Straße ins Gesicht schlug, sodass sie zu Boden fiel, nur weil sie sich an sein Auto gelehnt hatte. Ich habe einen Mann, der nicht älter als mein Vater war, tot an der Bushaltestelle liegen sehen und war dabei, als zehn bis fünfzehn junge Araber sich auf einem Straßenfest nachts auf eine Freundin von mir stürzten und ihr unter ihre Hose griffen. Mir wurde in der Bahn auf die Füße gekotzt, mehrmals haben Männer vor mir masturbiert, ich wurde angefasst, bedrängt, verfolgt und unzählige Male wüst beleidigt – fast immer von Ausländern.
Genau das ist das „Stadtbild“, von dem Friedrich Merz gesprochen hat – und es wird immer schlimmer, nicht besser. Trotzdem stellt sich eine ganze Reihe von Politikern der politischen Linken vor die Presse und verklärt den zaghaften – und viel zu undeutlichen – Versuch des Kanzlers, die Missstände anzusprechen, als rassistische Entgleisung. Linke gehen auf die Straße und demonstrieren unter dem Motto „Wir sind das Stadtbild“ oder „Wir sind die Töchter“. Dabei wissen sie in Wirklichkeit ganz genau, wovon Merz redet. Sie sehen die Verwahrlosung, lesen die Nachrichten und erleben zu großen Teilen auch selbst, was in den letzten Jahren aus Deutschland geworden ist. Aber sie schweigen. Mehr noch: Sie verklären bewusst die Realität und halten so das ganze System – das Elend und die Gewalt – am Laufen.

🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 99.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 99.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: