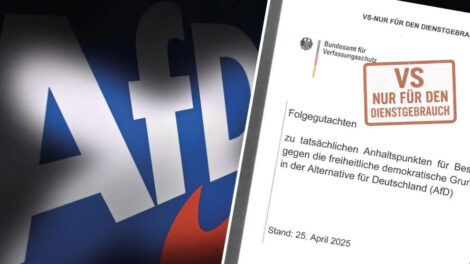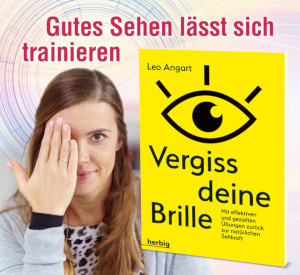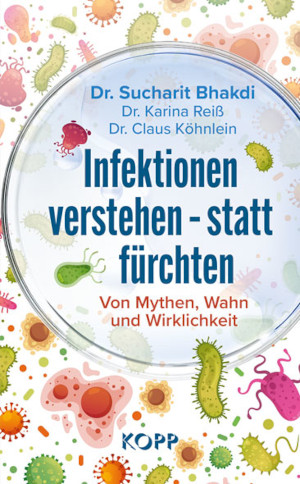Es gehört zum festlichen Inventar der Bundesrepublik: Die Wiedervereinigung als lineare Aufstiegsgeschichte. Freiheit, Wohlstand, westdeutsche Institutionen – und schon sei „alles besser“ geworden im Osten. Eine handfeste Lüge, wie so vieles in den vergangen 35 Jahren.
von Thomas Hartung
Diese patriotische Erzählung funktioniert wie ein Märchen: Sie glättet Brüche, erklärt Verluste zu marginalen Kollateralschäden und verweist die Zweifel derer, die anderes erlebt haben, ins Reich des Undankbaren. Genau diesen Mythos nennt die Sozialwissenschaftlerin Lara Bister in ihrer – trotz des brisanten Themas jüngst ausgezeichneten – Promotionsschrift ein „westdeutsches Wendemärchen“. Und die vorliegenden Daten geben ihr recht.
Wer die frühen 1990er im Osten als Kind oder Jugendlicher durchlebt hat, war Zeuge eines Totalumbaus: Betriebe fielen, Biografien wurden entwertet, Routinen brachen. Das traf nicht nur Erwerbsbiografien, sondern Familienklima, Selbstwirksamkeit und Zukunftsbilder. Die Effekte sind messbar: In einer Auswertung des Sozioökonomischen Panels (SOEP) berichten „Wendekinder“ – also die zum Zeitpunkt der Wende Minderjährigen – noch Jahrzehnte später von stärkerer psychischer Belastung als westdeutsche Vergleichsgruppen gleichen Jahrgangs und ähnlichen sozialen Hintergründen. Besonders betroffen: Frauen. Bisters Befund widerspricht dem bequemen Reflex, Differenzen mit dem Hinweis auf „neue Chancen“ zu übertünchen. Gewiss: Reisefreiheit, freie Berufswahl, pluralere Karrieren – all das zählt zwar; aber eine Erzählung, die systematisch die Preisfrage unterdrückt, erklärt sich selbst zur Ideologie. „Für manche wurde eben nicht alles besser“, sagt Bister – und genau so sei die Pauschalbehauptung vom allgemeinen Aufstieg „ein westdeutsches Wendemärchen“. Auf die über Nacht erlebte Grenzöffnung folgte die teils jahrelang erlittene Erfahrung, dass sich eine Tür nach der anderen wieder schloss.
Psychische Langzeitfolgen sind kein Ost-Exotikum
Die Märchenlogik arbeitet mit moralischen Zuschreibungen: Wer klagt, habe den Westen „nicht verstanden“ oder sei rückwärtsgewandt. Das Gegenteil ist der Fall: Die Daten zeigen, dass psychische Belastungen nicht auf individuelle „Defizite“ reduzierbar, sondern vielmehr Signaturen eines kollektiven Schocks sind. So zeigt die Untersuchung, dass die erhöhte psychische Belastung unabhängig davon auftritt, ob die Eltern arbeitslos wurden oder die Familie später in den Westen zog; der Wendeschock selbst wirkt fort. Diese Einsicht konterkariert den westdeutschen Belehrungsgestus, der die DDR-Vergangenheit pauschal als zentrale Ursache heutiger Probleme ausruft und die Nachwendejahre zur Erfolgsgeschichte verklärt. Bister betont: Die Lebensverläufe der Wendekohorte gleichen denen westdeutscher Jahrgänge – bis die Transformationskrise einsetzt.
Besonders deutlich zeigen sich Langzeitfolgen bei Frauen: geringere psychische Vitalität, häufiger Erschöpfung, in einer ergänzenden Analyse sogar Hinweise auf erhöhten Blutdruck- und Blutfettwerte – Marker für chronischen Stress. Das ist brisant: Ausgerechnet dort, wo die Ein-heitserzählung gerne mit „Emanzipationsdividende“ wirbt, finden wir eine stille Rechnung, die bis heute offensteht. Die geschlechtsspezifische Dimension legt frei, was der Märchenton übertönt: Frauen tragen Transformationslasten oft doppelt – im Erwerbsleben (Entwertung von Qualifikationen, prekäre Anschlussverhältnisse) und privat (Harmonisierungsdruck, Sorge, Verantwortung). Wer daraus eine moralische Schwäche ableitet, verwechselt gesellschaftlich induzierte Spannungen mit „fehlender Resilienz“.
Das moralische Problem: Anerkennung statt Pädagogisierung
Das Wendemärchen produziert ein Anerkennungsdefizit. Wer die Nachwendebelastungen anspricht, wird schnell in diskursive Quarantäne geschickt: „Jammer-Ossi“, „Opfermentalität“, „ostalgisch“. Bister berichtet hingegen, dass sich viele Wendekinder “gesehen” fühlen, sobald die Forschung ihre Erfahrung ernst nimmt. Genau diese Anerkennung ist die Voraussetzung für gesellschaftliche Kohäsion – nicht neue pädagogische Programme, die Ostdeutsche zur Anpassungsleistung an westliche Normalitäten verpflichten. Die “Süddeutsche Zeitung” rekonstruierte diesen blinden Fleck der Wissenschaftsgeschichte jetzt unmissverständlich: Von westdeutschen Deutern dominiert, habe die Forschung Chancen „überbetont“ und Herausforderungen marginalisiert. Wer genauer hinsieht, entdeckt auf persistente Belastungssignaturen – und zugleich Befunde, die simple Ost-Pathologisierungen widerlegen, etwa geringere berichtete Gewalterfahrungen in DDR-Sozialisation im Erwachsenenrückblick.
Einheitskritik ist nicht Nostalgie, sondern Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Wenn tiefgreifende Umbrüche die psychische Grundlage junger Generationen auf Jahre schwächen können, folgt daraus eine staatliche Fürsorgepflicht: Prävention, psychische Grundversorgung, soziale Sicherungen und familienbezogene Entlastungen müssen in Krisenzeiten hochgefahren werden – nicht als Almosen, sondern als verfassungsfester Schutz vor Transformationsschäden. Genau darauf weisen viele mediale Interviewpassagen Bisters wie etwa im Spiegel hin: Belastbarkeit entscheidet sich über Jahrzehnte, nicht in Förderperioden. Wer heute auf „Resilienztrainings“ setzt, ohne die strukturellen Stressoren von Marktliberalisierung, Entwertung von Qualifikationen und regionaler Deindustrialisierung zu adressieren, verwechselt Therapie mit Therapieersatz. Politisch bedeutet das: eine Wirtschaftspolitik, die Krisen abmildert, flankiert von einer Sozialpolitik, die Familien durch Krisen trägt – nicht darüber hinwegpredigt. Es geht um eine Fortschrittspflicht hin zum Fürsorgerecht.
Das blinde Machtfeld der Einheit
Das „westdeutsche Wendemärchen“ wirkt nicht nur als Deutungshoheit über Erfahrungen; es stabilisiert auch institutionelle Hoheiten. Dirk Oschmann hat gezeigt, dass der Osten im vereinten Deutschland systematisch “fremdbeschrieben” wird: als Abweichung von einer westdeutschen Norm, die sich selbst unsichtbar macht. Aus der kulturellen Asymmetrie folgt eine “Machtasymmetrie” – die Unterrepräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen ist kein Zufall, sondern Resultat eines dichten Geflechts aus Habitus, Netzwerken und Gatekeeping. In Oschmanns Lesart ist der Osten weniger „nachholend“, sondern wird provinzialisiert: Wer den Maßstab setzt, muss sich nicht rechtfertigen; wer ihm entsprechen soll, steht permanent unter Bewährungsdruck. Damit ergänzt die Repräsentationsfrage unsere Diagnose der psychischen Langzeitfolgen: Nicht nur Biographien wurden entwertet – auch Stimmen. Oschmanns Kernthese: Der Osten ist in den Zentren von Politik, Medien, Kultur und Wissenschaft überwiegend “Gegenstand”, also Objekt, selten Subjekt der Darstellung. „Ostdeutsch-land“ erscheint dort, wo Probleme verhandelt werden – Migration, Demokratieverdrossenheit, Rechtsextremismus –, während Ostdeutsche kaum dort sitzen, wo Rahmen und Agenden gesetzt werden.
Diese anhaltende Fremddefinition erzeugt ein diskursives Gefälle: Westdeutsche Erfah-rungen gelten als „allgemein“, ostdeutsche als „besonders“ – und damit erklärungsbedürftig, pädagogisierbar. Die gängigen Selbstentlastungen – „Pipeline leer“, „Qualifikationen fehlen“ – übersehen das kulturelle Kapital der Elitenreproduktion: Auswahlgremien, Stiftungslandschaften, Feuilletons, Parteizentralen veredeln habituelle Passung (Sprechweisen, Netzwerke, Bildungswege) zu vermeintlicher „Eignung“. Oschmanns Pointe: Nicht der „falsche“ Osten scheitert, sondern der homogenisierte Westen reproduziert sich. Wer nicht über westliche Seilschaften, Ortsbiographien oder Institutionensozialisation verfügt, bleibt die Ausnahme – oder wird zur “Quoten-Expertise” für Ostthemen abgerufen, nicht jedoch für allgemeine Leitfragen.
Provinzialisierung durch Deutungskorsette
Unterrepräsentanz ist auch eine Folge des Rahmens, in dem über den Osten gesprochen wird. Wenn Ostdeutsche vor allem als Demokratiesorgenkind erscheinen, wird ihr “gesellschaftliches Innovationskapital” – von “Chaoskompetenz” sprach die Ethnologin Juliane Stückrad im Spiegel: Unternehmensgründungen, kommunale Praxis, Transformationserfahrung – unsichtbar. Das bekräftigt negative Auswahlspiralen: Man sucht für zentrale Ämter jene, die den „richtigen Ton“ treffen – und der ist westdeutsch sozialisiert. Ergebnis ist eine “Doppel-Unsichtbarkeit”: Ostdeutsche fehlen auf den oberen Ebenen, und ihre Abwesenheit wird nicht als Skandal, sondern als “Normalität” wahrgenommen. Feiern, Gedenkjahre, Förderprogramme – all das erzeugt symbolische Sichtbarkeit bei gleichzeitig materieller Unsichtbarkeit in Leitungsgremien. Oschmann spricht von einem Ritualismus der Einheit, der Empathie ausstellt, ohne Kompetenzzugang zu öffnen.
Das Märchen der gelungenen Verschmelzung überblendet, dass die Schlüsselpositionen – Redaktionen, Intendanzen, Ministerialspitzen, Hochschulleitungen – überwiegend westdeutsch besetzt sind. Die Folge: Ostdeutsche erscheinen als Publikum der Einheit, nicht als deren Mitgestalter. Die Unterrepräsentanz erzeugt einen Rückkopplungseffekt: Wer sich in den Entscheidungszentren nicht wiederfindet, erkennt Entscheidungen schlechter als legitim an. Die vertraute Moralisierung („Populismus“, „Unreife“) verkennt, dass “Teilhabe” kein pädagogisches, sondern ein institutionelles Problem ist. Eine Republik, die die Transformationslasten des Ostens anerkennt, muss seine Erfahrungswissensträger dahin bringen, wo Zukunft definiert wird – nicht nachträglich als „Stakeholder“ beteiligen, sondern mitentscheiden lassen.
Korrekturprogramm ohne Bevormundung
Aus der Kritik folgt kein identitätspolitischer Bonus, sondern ein republikanisches Korrektiv. Zu denken sind an Transparenzpflichten für Auswahlverfahren und Gremienbesetzungen; Herkunft als offenzulegende Diversitätskategorie neben Geschlecht und sozialer Lage. Oder, noch weitergehend: Herkunft als Pfadöffner in Ausbildung und Karriere mit Fokus auf ostdeutsche Bildungs- und Berufsbiografien – nicht als Gnade, sondern als Nachholen strukturell blockierter Chancenräume. Auch Rotationsprinzipien und Amtszeitbegrenzungen in strategischen Spitzen, um geschlossene Netzwerke aufzubrechen, sowie die Umwidmung ostdeutscher Leitungskompetenz als Normalfall und nicht als Spezialthema sind zu bedenken.
Die Repräsentationsfrage ist die politische Seite der beschriebenen psychischen Langzeitfolgen. Wer Jahrzehnte nach der Wende erhöhte Belastung misst, darf nicht bei Therapieangeboten stehen bleiben, sondern muss Zugänge zu Macht und Sinn öffnen. Unterrepräsentanz reprodu-ziert Ohnmachtserfahrungen – Repräsentation transformiert sie in Verantwortung. Genau hier endet das Wendemärchen und beginnt Republik: nicht als Belehrung, sondern als geteilte Ver-fügung über die gemeinsame Zukunft.
Das nötige Gegen-Narrativ ist unbequem und produktiv: Die Einheit war zugleich Befreiung und Zumutung. Sie hat Freiheiten eröffnet und Schutzräume zerschlagen. Wer das zweite Glied un-terschlägt, betreibt Mythologie. Wer beides ausspricht, öffnet den Raum für gerechte Politik.
Rhetorik des Triumphs statt Trauerarbeit
Dazu gehören:
- Die Anerkennung der Langzeitfolgen bei der „Wendekinder“-Generation, insbesondere bei Frauen, vor allem mit Blick auf die arbeitsmarktpolitische Rücksicht auf Care-Biographien.
- Die Etablierung einer struktursensiblen Krisenpolitik statt symbolischer Integration; zu denken ist an einen Schutz vor biografischen Schocks wie Qualifikationsentwertung oder auch Übergangsgarantien.
- Kulturelle Fairness: Schluss mit dem moralischen Reflex, ostdeutsche Erfahrungen zu pädagogisieren! Anerkennung ist kein Trostpreis, sondern Grundlage politischer Loyalität.
Der Märchenton hat der Republik politisch nicht geholfen. Er produziert eine Rhetorik des Triumphs, wo Trauerarbeit nötig wäre, und eine Pädagogik der Anpassung, wo Fürsorge geboten ist. Wer die Einheit ernst nimmt, muss die Zumutungen beim Namen nennen – und die Betroffenen aus dem pädagogischen Objektstatus entlassen. Erst dann wird die Einheit zu dem, was sie sein sollte: keine Siegergeschichte mehr, sondern eine tragfähige Schicksalsgemeinschaft. Die vorliegenden Befunde sind Einladung und Auftrag zugleich: Entmystifizieren wir das „westdeutsche Wendemärchen“ – zugunsten einer Politik, die die seelische Topografie der Einheit mitdenkt und mitträgt!
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 72.500 Euro!
Um auch 2025 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 72.500 von 125.000 Euro. In einer normalen Woche besuchen im Schnitt rund 250.000 Menschen unsere Internetseite. Würde nur ein kleiner Teil von ihnen einmalig ein paar Euro spenden, hätten wir unser Ziel innerhalb kürzester Zeit erreicht. Wir bitten Sie deshalb um Spenden in einer für Sie tragbaren Höhe. Nicht als Anerkennung für erbrachte Leistungen. Ihre Spende ist eine Investition in die Zukunft. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für unsere Arbeit und unterstützen Sie ehrlichen Qualitätsjournalismus jetzt mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: