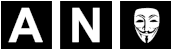Kulturstaatsministerin Claudia Roth bringt die deutsche Kolonial-, Migrations- und Demokratiegeschichte gegen die Geschichte der deutschen Vertriebenen in Stellung. Das ist mehr als bloß ein Symbol.
von Thorsten Hinz
Das in Oldenburg ansässige „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ in Oldenburg hat, wie schon gemeldet, die „Deutschen“ aus seinem Namen entfernt. Damit setzt es sich demonstrativ von Paragraph 96 des Bundesvertriebenengesetzes ab, der Bund und Länder verpflichtet, „entsprechend ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zuständigkeit das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewußtsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten“.
Dieser Auftrag soll laut Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) künftig in einer „allgemeinen Sprach- und Osteuropakompetenz“ aufgehen. Die früheren deutschen Staats- und Siedlungsgebiete werden nur noch als eine von mehreren Teilmengen eines transnationalen Kulturraums behandelt.
Das ist eine politisch-ideologische Entscheidung, welche die Idee von Nation, Volk, Staat und Territorium verabschiedet. Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, der CSU-Politiker Bernd Fabritius, hat das gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den Punkt gebracht: „Für uns als Verband und viele unserer Mitglieder fühlt es sich so an, als habe man sich ‘der Deutschen entledigt’, und wirke dadurch mit am Unsichtbarmachen eines originären Teils deutscher Geschichte. Unser Schicksal paßt wohl nicht mehr zum ideologischen Zeitgeist einer von ‘Mobilität und Migration geprägten Einwanderungsgesellschaft’.“ Der Entschluß ist folgerichtig und absehbar nur ein Zwischenschritt.
„Ich lehne Legenden ab, deutsche wie polnische“
Die Regierung unter Willy Brandt hatte in den Ostverträgen die territorialen Verluste akzeptiert. In der Fernsehansprache, die er 1970 von Warschau aus an das deutsche Publikum richtete, sagte er, es gehe „um den Beweis unserer Reife und um den Mut, die Wirklichkeit zu erkennen“. Gleichzeitig machte er deutlich: „Ich lehne Legenden ab, deutsche wie polnische. Die Geschichte des deutschen Ostens läßt sich nicht willkürlich umschreiben. (…) Dieser Vertrag bedeutet nicht, daß wir Unrecht anerkennen oder Gewalttaten rechtfertigen. Er bedeutet nicht, daß wir Vertreibungen nachträglich legitimieren.“ Das war vor 54 Jahren. Nach der Wiedervereinigung herrschte kurzzeitig Irritation über die Frage, welcher Obergriff für den kleineren der beiden Teile Deutschlands benutzt werden sollte.
In den fünfziger und sechziger Jahren hatte die politische Rhetorik unter der Parole: „Dreigeteilt? Niemals!“ West-, Mittel- und Ostdeutschland prospektiv zusammengefügt. Jetzt firmierte die DDR als „Ostdeutschland“, was den historischen Kultur- und Geschichtsraum jenseits von Oder und Neiße auch sprachlich abtrennte und weiter entfremdete.
Der im westpreußischen Marienburg geborene Historiker Hartmut Boockmann hielt sinngemäß dagegen: Weil „Ostdeutschland“ real ausgelöscht sei, könne das Wort korrekterweise nur noch als historische Bezeichnung Verwendung finden. Die Bezeichnung „Mitteldeutschland“ für die Ex-DDR implizierte in diesem Modell keinen territorialen Anspruch, sondern schloß das Bekenntnis zum physischen Ende des Ostens ausdrücklich ein.
Der blanke Unsinn vom „bunten Völkergemisch“
So sollte das Bewußtsein des Verlusts und gleichzeitig die Erinnerung an die historische und geistig-kulturelle Hinterlassenschaft wachgehalten werden. Doch soviel abstrakte Dialektik ließ sich kommunikativ nicht vermitteln. Außenpolitisch hätte sie Anstoß erregt. Der Kompromiß hieß: „Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ oder „Deutsche Geschichte im Osten Europas“. So lautete der Titel einer großangelegten Buchreihe des Siedler-Verlags, die 1992 mit dem Prachtband „Ostpreußen und Westpreußen“ von Hartmut Boockmann eröffnet wurde.
Der Kompromiß enthielt eine Unschärfe, die zum Einfallstor für Geschichtsverwässerer werden konnte. Und tatsächlich, als 1999 der Pommern-Band erschien, rieben Leser sich verwundert die Augen. In der Einleitung behauptete Herausgeber Werner Buchholz, Inhaber des Lehrstuhls für Pommersche Geschichte an der Greifwalder Universität, das bis 1945 deutsche Hinterpommern sei von einem „bunten Völkergemisch“ besiedelt gewesen. Das war blanker Unsinn, Mulikulti-Slang, dem Co-Autoren des Buches heftig widersprachen.
Schließlich hatte es im äußersten Ostpommern nur die kleine Minderheit der Kaschuben gegeben. Natürlich hatten im Zuge der jahrhundertealten Ostsiedlung sich Deutsche und Westslawen „längst ununterscheidbar miteinander vermischt“ (Sebastian Haffner), wie auch die Schweden, Russen, Franzosen und weitere Ethnien in den Kriegen des 17., 18. und 19. Jahrhunderts hier ihre Spuren hinterlassen hatten. Aus diesen Ingredienzien waren die Deutschen geformt worden, die 1945 vertrieben wurden.
Das „geteilte“ Erbe zeigt sich etwa in den sensiblen Danzig-Erzählungen von Pawel Huelle
Nun heißt es im Institutsprofil: „Multiple und hybride sprachliche, ethnische, politische und religiöse Zugehörigkeiten sind ebenso charakteristisch wie Migrationen und kulturelle Interferenzräume, die wir heute als gemeinsames Erbe, als Shared Heritage, untersuchen.“ Das ist kultursoziologisches Gelaber, wenn auch nicht völlig falsch. Das „geteilte“ oder „gemeinsame Erbe“ zeigt sich heute beispielsweise in den sensiblen Danzig-Erzählungen des kürzlich verstorbenen Schriftstellers Pawel Huelle. Den knappen Hinweis in Thomas Manns „Zauberberg“ auf die vier Semester, die Hans Castorp am Danziger Polytechnikum verbracht hatte, nahm Huelle zum Ausgangspunkt für den Roman „Castorp“, der dessen Danziger Vorgeschichte erzählt.
Der neue Roman „Empusion“ (2023) der polnischen Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ist eine „Zauberberg“-Adaption, die in der schlesischen Heimatregion der Autorin spielt. In einem Interview sagte Tokarczuk, daß die vertriebenen Deutschen ihre Geschichten und Mythen mitgenommen und die nachrückenden Polen somit auch geistig eine leere Region vorgefunden hätten.
Dieses Vakuum füllt sie nun mit ihrer überquellenden Phantasie und im Rückgriff auf alte Mythen neu auf. Das sind großartige und fruchtbare Entwicklungen, die zu analysieren und zu würdigen sind. Aber diese transnationalen Interferenzen werden als Nebelwand mißbraucht, hinter der die reale Vergangenheit der Vertreibungsgebiete ihre Konturen verliert.
Massenvertreibung der Deutschen wird mit der Massenmigration verglichen
Der geschichtspolitische Generalschlüssel der Bundesrepublik wird nun auch in Oldenburg zur Brechstange: Das östliche Europa sei „zum Schauplatz der beispiellosen deutschen Besatzungs- und Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg (geworden). Es folgten Fluchtbewegungen und Zwangsmigrationen, die die Bundesrepublik, die DDR und das vereinigte Deutschland ebenso geprägt haben wie die Ankunft der (Spät-)Aussiedler aus den Staaten des östlichen Europa und die postsowjetische Migration. Die Geschichten dieser Menschen sind für uns nicht Vergangenheit, sondern Teil der postmigrantischen Gegenwart Deutschlands.“
Den Abschnitt und insbesondere den letzten Halbsatz muß man sich auf der Zunge zergehen lassen. Indirekt zwar, aber unmißverständlich werden die Massenvertreibung der Deutschen und ihre Aufnahme im Westen auf eine Stufe mit der Ankunft der Gastarbeiter oder dem aktuellen Massenansturm muslimischer junger Männer gestellt. Alle sind „Migranten“. Wohin die Reise im Institut künftig geht, deutet ein aktuelles Projekt an: „Diskriminierung von Menschen osteuropäischer Herkunft auf dem Arbeitsmarkt“. Gefördert wird es von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Wer das Wissen über seine Vergangenheit verliert, der verliert die Kontrolle über die Gegenwart und Zukunft. Es geht nicht nur um historische und moralische, sondern auch um politische, um macht- und außenpolitische Fragen. Noch immer wird die Bundesrepublik mit Forderungen penetriert, die aus dem Zweiten Weltkrieg herrühren. Im Gegenzug könnte sie auf die unbezifferbaren Vermögensübertragungen hinweisen, die mit der Vertreibung einhergingen und die ebenfalls zum „gemeinsamen Erbe“ gehören. Die Umbenennung des Instituts ist ein Detail einer desaströsen Geschichtspolitik, die sich im „Rahmenkonzept Erinnerungskultur“ niederschlägt, das Kulturstaatsministerin Roth kürzlich vorgelegt hat. Es knüpft an den Koalitionsvertrag der Ampel an, in dem es heißt: „Wir begreifen Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und Weg in eine gemeinsame Zukunft.“
Die absurde Akzentsetzung der deutschen Kolonialgeschichte
Als Wegmarken sind die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte, mit der SED-Diktatur – immerhin! – und der Kolonialvergangenheit vorgesehen. Außerdem soll die Geschichte Deutschlands als Einwanderungsland erzählt und die deutsche Demokratiegeschichte – was immer man aktuell darunter versteht – gewürdigt werden. Vorgesehen ist ein Lern- und Erinnerungsort, der „über die deutsche und europäische Kolonialherrschaft insbesondere in Afrika“ und deren Folgen aufklären soll.
Das ist eine völlig absurde Akzentsetzung, denn die deutsche Kolonialgeschichte war im Vergleich zur britischen, französischen, spanischen, portugiesischen, holländischen nur marginal gewesen. Außerdem soll die Geschichte der Gastarbeiter und Asylanten und in dem Zusammenhang auch die Geschichte „rechter Gewalt“ thematisiert werden. Der Entwurf sieht einen Erinnerungsort für die Opfer des NSU, ein Dokumentationszentrum und ein virtuelles Archiv vor.
Diskutabel ist das nicht mehr
Deutsche Geschichte und Zeitgeschichte werden im Modus der Schwarzen Pädagogik präsentiert. Der Zweck ist klar: Auf dem Weg ins schöne neue Regenbogenland sollen wir die dunkle deutsche Vergangenheit und Gegenwart hinter uns lassen und zu postmigrantischen Zombies werden.
Der Entwurf hat viel Kritik hervorgerufen, die aber kaum substantiell war, im Gegenteil. Die Kritiker sehen vor allem die Gefahr, daß die neue Fokussierung auf den Kolonialismus den Holocaust relativiert. Die Unionsfraktion im Bundestag fordert daher verpflichtende Besuche von KZ-Gedenkstätten für alle Schüler in Deutschland.
Man muß Claudia Roth zugestehen, daß zu diesem Interessenkonflikt in ihrem Haus bereits tiefsinnige Überlegungen angestellt wurden, die in einem Satz von Habermasschem Format zusammenfließen: „Sollen und können wir nach Verflechtungen (und Unterschieden) zwischen Nationalsozialismus und Kolonialismus, Antisemitismus und Rassismus im Sinne einer verbindenden Erinnerungskultur suchen, oder birgt die Kontextualisierung, Relationierung und Neu-Perspektivierung genozidaler Menschheitsverbrechen und der ihr zugrundeliegenden Ideologien die Gefahr einer Relativierung, gar Verharmlosung der Einzigartigkeit der Shoah und der mit ihr verbundenen These vom Zivilisationsbruch?“ Diskutabel ist das nicht mehr. Wer bei Verstand bleiben will, muß die woke Zombie- und Gespensterwelt hinter sich lassen.
Retten Sie das Meinungsklima!
Ihnen gefallen unsere Inhalte? Zeigen Sie Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute, ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl!