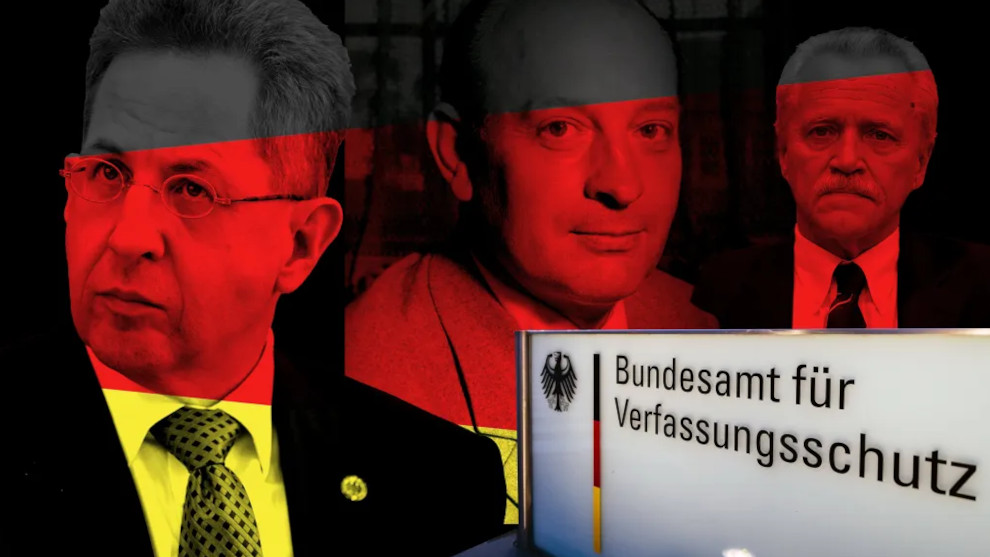Seit seiner Gründung im Jahr 1950 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz immer wieder für handfeste Skandale gesorgt. Diejenigen, die in dieser Behörde vorgaben, die Demokratie beschützen zu wollen, waren stets auch diejenigen, die den Rechtsstaat bei jeder Gelegenheit mit Füßen traten. Die Geschichte der Behörde gleicht einer Skandalchronik.
von Sven Reuth
27. Juni 1952, ein Frühsommertag in Bochum: Bei einer FDP-Kundgebung spricht das damalige Bundesvorstandsmitglied Erich Mende – später langjähriger Vorsitzender der Partei – und trägt dabei sein Eisernes Kreuz, das er sich im Zweiten Weltkrieg als Offizier der Wehrmacht erworben hatte. Der spätere Vizekanzler der Bundesrepublik hätte wohl niemals erahnt, dass er damals von Mitarbeitern des zwei Jahre zuvor gegründeten Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) beobachtet wurde. Dieses pikante Detail schildert Wolfgang Buschfort in seinem Buch Geheime Hüter der Verfassung. Die FDP schien damals aus Sicht der Kölner Behörde zu kippen. So wurden die Delegierten des Bundesparteitags 1952, der im Kurhaus von Bad Ems stattfand, mit Marschmusik und schwarz-weiß-roten Fahnen begrüßt. Die damals insbesondere vom nordrhein-westfälischen Landesverband verfochtene Idee, die Freien Demokraten als klar nationalliberal ausgerichtete Kraft im Parteienspektrum zu verankern, konnte sich nicht durchsetzen – auch deshalb nicht, weil das Vorhaben den Inlandsgeheimdienst und die Besatzungsmächte auf den Plan rief.
Obwohl das BfV nach dem zwischenzeitlichen und bis heute ungeklärten Abgang seines ersten Präsidenten Otto John in die DDR schnell in dem Ruf stand, eine Skandalbehörde zu sein, erfüllte es aus Sicht der Innenminister seine Funktion als Ausputzer und Gesinnungspolizei innerhalb des bundesdeutschen Parteiensystems. Die Ämter lieferten das Material zum Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) 1952 und der KPD 1956, sie nahmen aber auch einen nationalrevolutionären Hitler-Gegner wie Otto Strasser ins Visier, der bis 1955 durch eine rechtswidrige Einreiseverweigerung aus der Bundesrepublik ferngehalten worden war. Insgesamt verliefen die ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte aus Sicht der VS-Behörden wohl unproblematischer, als man es selbst für möglich gehalten hätte – die KPD scheiterte nach ihrem Verbot weitgehend an der Organisation eines Untergrundapparats, und das nationale Spektrum blieb durch Streitigkeiten gelähmt.
S-Bahn-Peter besorgt Waffen
Mit dem Aufkommen von Studentenbewegung und Außerparlamentarischer Opposition (APO) gegen Ende der 1960er Jahre sah sich der Verfassungsschutz aber mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Große Teile einer ganzen Generation wandten sich der extremen Linken zu. In den frühen 1970er Jahren bekundeten in Umfragen bis zu 30 Prozent der 19- bis 28-Jährigen Sympathie für die Rote-Armee-Fraktion (RAF).
Der Staat zündelte hierbei kräftig mit. Dieser Wahnsinn hatte Methode: So sollte offensichtlich erreicht werden, dass sich die neue Bewegung in den Augen der Öffentlichkeit mit schweren Verbrechen rasch selbst diskreditiert. Eine zentrale Rolle bei der Transformation militanter linker Milieus in erste terroristische Gruppen spielte Peter Urbach, ein früherer Mitarbeiter der Ost-Berliner S-Bahn und Agent Provocateur des West-Berliner Verfassungsschutzes, «der in den diversen APO-Kollektiven als ”S-Bahn-Peter” ein und aus ging und bis in die Anfänge der RAF für nahezu alle ”bewaffneten Aktionen” die Mollies, Bomben oder Pistolen lieferte», wie Gerd Koenen in seinem Buch Das rote Jahrzehnt feststellt. Obwohl es damals schon viele V-Mann-Gerüchte um Urbach gab, lud ihn APO-Anwalt Horst Mahler im April 1970 in seine Berliner Kanzlei, wo schon Andreas Baader wartete. Die beiden Zentralfiguren der RAF baten Urbach um Hilfe bei der Waffenbeschaffung, die dieser prompt zusagte.
Der V-Mann des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) hatte schon zwei Jahre zuvor die sogenannten Osterunruhen, die bis dahin schwersten Ausschreitungen in der Geschichte der Bundesrepublik mit zwei Todesopfern, entfesselt, als er zündfertige Molotowcocktails an die Demonstranten vor dem Axel-Springer-Hochhaus verteilte. Anderthalb Jahre später lieferte S-Bahn-Peter die Bombe für das versuchte Attentat der Tupamaros West-Berlin auf das Jüdische Gemeindehaus in Charlottenburg. Der Zeitzünder hatte ausgelöst, nur die Überalterung der Zündkapsel verhinderte eine Katastrophe. Laut einem Gutachten der Berliner Polizei hätte die Bombe «das Haus zerfetzt» und einen Großteil der dort versammelten 250 Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung getötet.
Die Zerstörung der Republikaner
Die Berliner Abgeordnetenhauswahlen vom 29. Januar 1989 lösten ein politisches Erdbeben aus: Mit den Republikanern (REP), die 7,5 Prozent erreichten, zog erstmals seit den 1960er Jahren wieder eine rechte Partei in einen Landtag ein. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR eröffnete sofort eine «Feindobjektakte Republikaner» und legte einen politisch-operativen Maßnahmenplan auf. Wenige Monate später zogen auch die westdeutschen Behörden nach. In seinem 2013 erschienenen Buch Verfassung ohne Schutz brüstet sich Winfried Ridder, früherer Chefauswerter Terrorismus des BfV, damit, im Frühjahr 1989 mit einem an die Innenminister verschickten Thesenpapier dafür gesorgt zu haben, «die Republikaner als ”Beobachtungsobjekt” zu führen». So wurde Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Zugang zur Partei versperrt und diese in den Augen der Öffentlichkeit stigmatisiert. Dabei waren die REP keine rechtsextreme, sondern eine nationalkonservative Partei, die 1983 aus Empörung über die von Franz Josef Strauß an die DDR vergebenen Milliardenkredite gegründet worden war. Ihr von den Diensten schließlich verhinderter Durchbruch verzögerte die Entstehung eines patriotischen Korrektivs zum etablierten Parteienkartell um ein Vierteljahrhundert.
Als der Waffenlieferant der Szene jedoch im Mai 1971 im Prozess gegen Horst Mahler wegen Beihilfe zur Gefangenenbefreiung von Andreas Baader aussagte, war seine Legende nicht mehr zu halten. Er tauchte ab. 2011 wurde gemeldet, dass er im kalifornischen Santa Barbara verstorben sein soll.
Becker und Buback
Urbach ist nicht die einzige Skandal-Personalie des Berliner Landesamtes der damaligen Jahre. Als mindestens ebenso fragwürdig muss die Rolle von Michael Grünhagen bewertet werden. Unter dem Decknamen «Peter Rühl» war der Beamte der V-Mann-Führer von Ulrich Schmücker, einem Terroristen der Bewegung 2. Juni, der am 5. Juni 1974 wegen seiner Spitzeltätigkeit zum Opfer eines Fememords im Grunewald wurde. Die Tat ließ sich in vier Prozessen, die bis 1991 andauerten, nicht aufklären, da der Verfassungsschutz die Beweislage nach Belieben manipulierte. Klar ist nur, dass sich an der Tatwaffe, einer Luger-Pistole, die sich für 15 Jahre in einem Tresor des Amtes befand, nur die Fingerabdrücke des V-Mannes Volker Weingraber sowie von Grünhagen selbst fanden.
Zusammen mit Schmücker begann auch die spätere RAF-Terroristin Verena Becker ihre verbrecherische Karriere in der Bewegung 2. Juni. Der Historiker Wolfgang Kraushaar ist davon überzeugt, dass sie genau wie ihr später ermordeter Gesinnungsgenosse auch von «Peter Rühl» oder einem anderen LfV-Mitarbeiter schon während ihrer ersten dreijährigen Haftzeit zu Beginn der 1970er Jahre umgedreht wurde und fortan für das Amt arbeitete. Das ist ein Verdacht von ungeheurer Tragweite.
Im Februar 1975 wurde die gebürtige Berlinerin im Gegenzug für die Freilassung des entführten Berliner CDU-Politikers Peter Lorenz mit vier weiteren Terroristen freigepresst und in den Jemen ausgeflogen, wo sie der RAF beitrat und sich gemeinsam mit ihrer neuen Gruppe auf die sogenannte Offensive 77 vorbereitete. Eine geradezu erdrückende Indizienlast spricht dafür, dass sie es war, die am 7. April 1977 Generalbundesanwalt Siegfried Buback in Karlsruhe ermordete, dennoch leitete die Bundesanwaltschaft alle Ermittlungen in diesem Fall geradezu systematisch um sie herum. Kraushaar schreibt in seinem Buch Verena Becker und der Verfassungsschutz von einer «verschleppten Staatsaffäre» und verweist dabei auch auf ein 1978 erstelltes Dokument der Stasi. In diesem wird festgestellt, dass Becker schon «seit 1972 von westdeutschen Abwehrorganen (…) unter Kontrolle gehalten wird».
Nicht immer jedoch hatten die Skandale des Verfassungsschutzes etwas mit Terrorismus zu tun. Es konnte sich – wenn auch in ungeheuerlichen Dimensionen – um gewöhnliche Kriminalität handeln, so wie im Fall des CSU-Politikers und früheren BfV-Präsidenten Ludwig-Holger Pfahls. Dieser wurde wegen seiner Rolle in den Schmiergeldskandalen rund um die Privatisierung der Minol-Tankstellenkette durch die Treuhand sowie von Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien nach seinem Untertauchen im Jahr 1999 mit internationalem Haftbefehl gesucht.
Die Schredder laufen heiß
Nach der Wiedervereinigung wurden die VS-Behörden dann erneut vor eine große Herausforderung gestellt. Unzählige Kameradschaften und sonstige rechtsextreme Gruppen versuchten, in die Sinnkrise und das Vakuum hineinzustoßen, das die Implosion der DDR insbesondere bei der Wendejugend in den neuen Bundesländern hinterlassen hatte.
Wieder schütteten die Ämter Öl in ein ohnehin schon loderndes Feuer, statt sich auf die Bekämpfung politischer Straftaten zu konzentrieren. Die Neonazi-Szene wurde mit V-Leuten regelrecht überschwemmt. Allein beim Thüringer Heimatschutz, dem Kameradschaftsverbund, in dem Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt politisch sozialisiert wurden, sollen 40 Mitglieder und damit etwa ein Drittel des gesamten Netzwerkes für diverse Nachrichtendienste gearbeitet haben.
Das alles musste wohl erneut in einer Katastrophe enden, die diesmal in der bis heute unaufgeklärten NSU-Mordserie gipfelte. Sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch die Landesämter in Sachsen und Thüringen dürften immer dicht dran am Geschehen gewesen sein. Schon am 11. November 2011 – also dem Tag, an dem der Generalbundesanwalt die NSU-Ermittlungen an sich zog – schredderte der Leiter des Referats Forschung und Werbung beim BfV sieben Akten der Behörde zu V-Mann-Anwerbeaktionen im Umfeld des späteren NSU. Wie es wirklich war, wird sich deshalb kaum mehr rekonstruieren lassen.
Der Verfassungsschutz bleibt damit weiterhin eine Black Box, die sich außerhalb jeder ernsthaften Kontrolle durch demokratische Institutionen befindet, denn das gerade einmal aus neun Abgeordneten bestehende Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages kann diese Mammutaufgabe nicht leisten. Mit weiteren Skandalen ist deshalb auch in Zukunft zu rechnen.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 102.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 102.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: