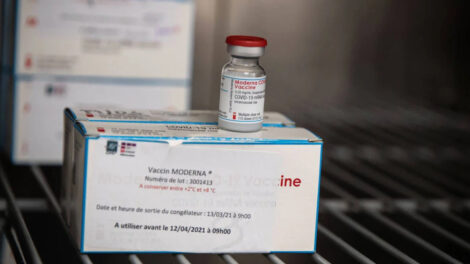Das Paul-Ehrlich-Institut lancierte im Dezember 2020 eine eigene Studie zur aktiven Überwachung der Sicherheit der Corona-Impfstoffe. Ergebnisse wurden aber bis heute nicht veröffentlicht. Die Behörde und das Bundesgesundheitsministerium mauern. Eine Juristin klagt seit Jahren auf Herausgabe der Daten.
von Lena Böllinger
Im Mai dieses Jahres startete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine „digitale Aufklärungskampagne gegen Falschinformationen“ mit dem Titel „Impfstofffakten gegen Mythen“. Das PEI ist die in Deutschland zuständige Bundesbehörde für die Zulassung und die Überwachung der Sicherheit von Arzneimitteln – dazu gehören auch Impfstoffe. Insgesamt zehn „Fakten“ und „Mythen“ stellt das PEI im Rahmen der Kampagne gegenüber. So heißt es etwa gleich zu Beginn: „Fakt ist: Nebenwirkungen werden transparent kommuniziert.“ Entkräftet werden soll damit der „Mythos“, dass die Nebenwirkungen von Impfungen „verschleiert“ würden. An anderer Stelle in der Liste heißt es: „Fakt ist: Risiken und Nebenwirkungen von Impfstoffen werden weltweit sehr genau überwacht“, um damit dem „Mythos“ entgegenzutreten, die Nebenwirkungen und Risiken von Impfungen seien „unkalkulierbar“. Das PEI schreibt weiter: „Schwere Nebenwirkungen nach einer Impfung sind selten, aber sie kommen vor. Es ist wichtig, dass jede jeder über die möglichen Risiken von Impfstoffen aufgeklärt wird.“
Aus Sicht der Anwältin und ehemaligen Richterin Franziska Meyer-Hesselbarth sind Ärzte im Fall der neuartigen Corona-Impfstoffe aber gar nicht in der Lage, ihre Patienten wirklich aufzuklären. Bei einem Vortrag, den sie im Mai in Bremen hielt, erläuterte sie, dass die Verabreichung einer Impfung ohne wirksame Einwilligung der Patienten aus juristischer Sicht eine Körperverletzung darstelle: „Und wann ist die Einwilligung unwirksam?“ fragte die Juristin, um gleich darauf die Antwort zu geben: „Ja ganz einfach, wenn die Aufklärung nicht ordnungsgemäß war.“ Eben eine solche ordnungsgemäße Aufklärung konnten und können Ärzte laut Meyer-Hesselbarth bis heute nicht leisten. Der Grund: das PEI gebe relevante Sicherheitsdaten nicht heraus beziehungsweise mache sie den Ärzten nicht zugänglich. Damit, so schlussfolgerte Meyer-Hesselbarth, leiste das Paul-Ehrlich-Institut indirekt von Ärzten begangenen Körperverletzungen Vorschub.
Wie kommt die Juristin zu solch gravierenden Vorwürfen, die noch dazu in krassem Widerspruch zu den Aussagen der Aufklärungskampagne des PEI stehen? Franziska Meyer-Hesselbarth führt seit über drei Jahren einen Rechtsstreit mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Sie möchte, dass das PEI Daten der SafeVac 2.0 App herausgibt. Warum diese Daten so wichtig – und möglicherweise brisant – sind, wird klar, wenn man sich vor Augen führt, wie genau Risiken und Nebenwirkungen von Impfungen überwacht werden. Diese Überwachung – im Fachjargon spricht man auch von „Pharmakovigilanz“ – kann passiv oder aktiv stattfinden. Zur passiven Pharmakovigilanz gehört das sogenannte Spontanmeldesystem. Wie der Name schon sagt, werden mögliche Nebenwirkungen hier spontan – und nicht systematisch – erfasst. Jeder und jede kann einen Verdachtsfall melden – Ärzte und Apotheker sind zur Meldung verpflichtet, ebenso das pharmazeutische Unternehmen, das die Impfstoffzulassung hält.
Aktive und passive Pharmakovigilanz
Ein großes Problem des Spontanmeldesystems ist jedoch, dass die meisten Verdachtsfälle gar nicht erst gemeldet werden, man also von einer enormen Untererfassung ausgehen muss. Im „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ – herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit und dem Paul-Ehrlich-Institut – aus dem Jahr 2017 heißt es (Seite 30), „nur etwa sechs Prozent“ aller Nebenwirkungen und nur „fünf bis zehn Prozent“ der schweren Nebenwirkungen würden Schätzungen zufolge gemeldet. Will heißen: es gibt eine Untererfassung im Spontanmeldesystem von etwa 90 bis 95 Prozent.
Dieses Manko kann mit aktiver Pharmakovigilanz ausgeglichen werden. Hier wird nicht einfach abgewartet, ob „spontan“ Nebenwirkungen gemeldet werden und falls ja, welcher Art, sondern es wird systematisch nachgefragt und ausgewertet. Genau das war auch die Idee hinter der SafeVac 2.0 App. Auf seiner Seite schrieb das PEI im Dezember 2020:
„Mit Hilfe der App werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv drei bzw. vier Wochen nach jeder COVID-19-Impfung nach gesundheitlichen Beschwerden (siebenmal innerhalb von 3 Wochen nach der ersten Impfung und achtmal innerhalb von 4 Wochen nach der zweiten Impfung) befragt. Weitere Befragungen zum gesundheitlichen Befinden erfolgen sechs und 12 Monate nach der letzten Impfung. Gegenstand der Abfrage ist auch, ob die Impfung vor einer SARS-CoV2-Infektion geschützt hat oder ob eine Infektion bzw. COVID-19-Erkrankung aufgetreten ist.“
Zweifelsohne wichtige Fragen und wichtige Daten. Zudem wurde in der App erfasst, welche Impfstoffcharge verimpft wurde – ebenfalls keine unwesentliche Information, wenn beispielsweise Hinweise auftauchen, dass bestimmte Chargen verunreinigt sind oder ein erhöhtes Schädigungspotential aufweisen. Die Teilnahme an der „Beobachtungsstudie“ war anonym und freiwillig. Offenbar waren viele Menschen vom Konzept der Studie überzeugt und vertrauten ihre Daten dem PEI an. Rund 740.000 Menschen haben mitgemacht.
All diese Menschen und die interessierte Öffentlichkeit – darunter viele Impfgeschädigte – warten jedoch bis heute auf die Auswertung der Daten. Die Impfkampagne mit den völlig neuen, notfallzugelassenen Präparaten startete vor fast fünf Jahren. Offiziell sollte die Datenerhebung „Ende 2023“ abgeschlossen sein, also vor fast zwei Jahren. Das Paul-Ehrlich-Institut brachte bis heute keine einzige wissenschaftliche Publikation zu den Daten zu Papier.
Daten einer ähnlichen App aus den USA sind besorgniserregend
Zum Vergleich: In den USA gab es eine ähnliche App mit dem Namen „v-Safe“. Die zuständige Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schreibt, die Daten seien inzwischen in mehr als 20 wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. Interessanterweise gab es aber auch in den USA Streit um die Herausgabe der Daten. Das „Informed Consent Action Network“ (ICAN) musste zweimal klagen, bevor es nach über einem Jahr per Gerichtsbeschluss die Daten der rund zehn Millionen App-Nutzer im Oktober 2022 erhielt. ICAN bereitete die Daten in einem eigens erstellten Dashboard visuell auf.
Die Auswertung ergab unter anderem: rund acht Prozent der Nutzer berichteten, nach der Impfung ärztlich behandelt worden zu sein. Eine repräsentative Forsa-Umfrage kam vergangenes Jahr für Deutschland zum gleichen Ergebnis: Acht Prozent der Geimpften waren nach der Impfung wegen Beschwerden beim Arzt. In den USA mussten von denjenigen, die ärztlich Hilfe suchten und über drei Jahre alt waren, rund 25 Prozent notfallmedizinisch behandelt oder hospitalisiert werden („emergency room“, „hospitalization“). Das sind umgerechnet zwei Prozent aller Nutzer der App, insgesamt rund 185.000 Amerikaner. Aus den Daten geht auch hervor, dass ein Großteil der Beschwerden kurze Zeit nach der Impfung auftrat. Rund 60% der Fälle wurden in den ersten sieben Tagen nach der Impfung gemeldet. In den ersten 28 Tagen nach Impfung waren es rund 80 Prozent. ICAN schrieb 2022, die Daten hätten das CDC dazu veranlassen müssen, „sein Covid-19-Impfstoffprogramm sofort einzustellen“.
Es gibt also Grund zur Annahme, dass die deutschen Daten ebenfalls besorgniserregend ausfallen – und möglicherweise ein schnelles behördliches Eingreifen erforderlich (gewesen) wäre, um die Verimpfung der neuartigen Präparate viel stärker zu reglementieren oder sogar ganz zu stoppen.
PEI 2022: Datenauswertung durch „Dritte“ könnte zu „Verzerrung der Ergebnisse“ führen
Im März 2022 stellte Franziska Meyer-Hesselbarth eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, um sowohl an die Rohdaten, als auch an mögliche Zwischenauswertungen des Instituts heranzukommen. Das Institut verweigerte die Herausgabe der Daten, die Anwältin klagt daher seit 2022 – also seit über drei Jahren – vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt. Die Biologin Sabine Stebel hat den Streit auf ihrer Seite unter der Überschrift „eine Chronologie der Verschleierung“ ausführlich dokumentiert. Tatsächlich bringt die Behörde im Laufe der Zeit immer neue und immer merkwürdigere Argumente vor, mit der sie versucht, das Auskunftsbegehren abzuwehren.
So gab das PEI 2022 an, die Rohdaten Meyer-Hesselbarth erst „nach Beendigung der Studie und der Veröffentlichung der Ergebnisse“ zur Verfügung stellen zu wollen. Der Grund:
„Eine Publikation, und damit der öffentliche Zugang zu den Ergebnissen der Studie, wäre nach einer vorherigen Herausgabe der Daten nicht mehr möglich. Wissenschaftliche Journals publizieren Artikel nur, wenn Forschungsdaten noch nicht veröffentlicht sind und zu neuen Erkenntnissen führen.“
Sabine Stebel überzeugt das nicht. „Das PEI lügt hier schamlos“, schreibt sie. „Natürlich kann man Daten vorab präsentieren. Das macht jeder Wissenschaftler auf Konferenzen als Poster oder in Vorträgen“. Vorabpublikationen stünden lediglich Patentierungen entgegen, nicht aber wissenschaftlichen Publikationen.
Zudem befürchtete das PEI, die „Herausgabe und damit eine mögliche Veröffentlichung der Daten durch Dritte könnte bei den Teilnehmenden eine Voreingenommenheit erzeugen, die zu einer Verzerrung der Ergebnisse (Bias) führen könnte. Insbesondere, wenn Dritte die Daten selektiv auswerten und interpretieren“.
Auch dieses Argument wirft Fragen auf – denn statistische Auswertungen beziehungsweise die zugrundeliegende methodische Vorgehensweisen sind auch behördlicherseits nicht unfehlbar und schon gar nicht unhinterfragbar. So machte die Journalistin Aya Velázquez erst kürzlich darauf aufmerksam, dass das PEI bei der Auswertung der Auswertung der Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen auf einen „manipulationsanfälligen“ WHO-Algorithmus zurückgreift. Velázquez konstatiert im Resümée ihrer umfangreichen Recherche:
„Die WHO-Software hilft offenbar dabei, die Zahl anerkannter Fälle klein zu rechnen. Das bedeutet für das Paul-Ehrlich-Institut weniger Sicherheitssignale, weniger Arbeit, weniger Skandal und weniger Rechtfertigungsdruck, warum man nicht früher Alarm geschlagen hat.“
Vor diesem Hintergrund wäre es für Impfgeschädigte möglicherweise von großem Nutzen, wenn nicht nur das PEI, sondern auch „Dritte“ die Daten „auswerten und interpretieren“.
Ausbleibende Interimsanalysen und eine fragwürdige Zwischenauswertung
Allerdings versprach das PEI – ebenfalls 2022 – noch „weitere Interimsanalysen“ „in den Sicherheitsberichten bzw. auf unserer Homepage zu veröffentlichen“. Das ist dann aber – bis heute – nicht passiert. Lediglich im August 2023 veröffentlichte das Institut eine „Auswertung der SafeVac 2.0-Studie“, um eine von dänischen Forschern festgestellte chargenbezogene Häufung von Verdachtsfallmeldungen bei Impfungen mit den Pfizer / BionTech-Präparaten zu dementieren.
Matthias Reitzner, Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, begutachtete die Stellungnahme des PEI und schlussfolgerte, die Auswertung der Bundesbehörde verfehle „vollständig“ jedes wissenschaftliche Niveau. In einem Interview sagte er im November 2024:
„Mit anderen Worten, die paar Zahlen, die in der Stellungnahme veröffentlicht wurden, beweisen exakt das, was von der dänischen Studie ebenfalls nahegelegt wurde: nämlich, dass die Verdachtsfälle sich sehr unterschiedlich auf die Chargen verteilen. Doch genau kann man das erst ernsthaft sagen, wenn die Daten veröffentlicht werden. Die werden aber bisher weiter geheim gehalten“.
Ein Versagen in Sachen Pharmakovigilanz will das PEI in dieser Geheimhaltung aber nicht sehen. Denn schließlich, so schrieb das Institut 2022 an Meyer-Hesselbarth, würden die via SafeVac 2.0 App gemeldeten „Verdachtsfälle auf eine Impfkomplikation“ ja sowohl in die Nebenwirkungsdatenbank des Paul-Ehrlich-Instituts als auch in die europäische EudraVigilance-Datenbank „eingespeist“ werden:
„Damit stehen die Daten aus der SafeVac-App auch für die kontinuierliche Überwachung der Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe zur Verfügung. Der Beitrag zur Wahrung der öffentlichen Gesundheit ist damit gegeben.“
Doch mit dieser Beschwichtigung offenbarte das PEI bereits 2022 einen höchst fragwürdigen Umgang mit den eigenen Datensätzen: Es vermischte offenbar Daten der aktiven Pharmakovigilanz der SafeVac 2.0 App (niedrige Untererfassung von Nebenwirkungen) mit denen der passiven Pharmakovigilanz des Spontanmeldesystems (hohe Untererfassung von Nebenwirkungen). Der Wirtschaftsjournalist Norbert Häring schrieb erst kürzlich:
„Wenn das PEI diese Meldungen tatsächlich – wie behauptet – in die Datenbank mit den Spontanmeldungen hat einfließen lassen, und bei der Auswertung nicht nach der Herkunft der Meldung unterschieden hat, hat es damit die – mutmaßlich hohe – Nebenwirkungsrate aus SafeVac vertuscht“.
Die Redaktion wollte daher Ende Juli vom PEI wissen, ob es diese Vermischung unterschiedlich erhobener Daten für ein Problem hält und wie es sicherstellt, dass es dadurch nicht zu einer Verwässerung der mutmaßlich höheren Nebenwirkungsrate aus der SafeVac 2.0-Erhebung kommt. Beide Fragen ließ das PEI bis Redaktionsschluss unbeantwortet.
PEI 2023: SafeVac 2.0 Daten unterliegen „Schutz des geistigen Eigentums“
Im Jahr 2023 brachte das PEI im Rechtsstreit mit Meyer-Hesselbarth weitere Argumente vor, warum die Daten nicht herausgegeben werden könnten. Die Daten seien zu „Forschungszwecken erhoben“ worden. Den Forschenden müsse zunächst die Möglichkeit eingeräumt werden, „das Ziel der Datenerhebung in Form des Abschlusses des Forschungsvorhabens und der Erfüllung des Forschungszwecks zu erreichen“. Zudem stünde der Herausgabe der Rohdaten auch „der Schutz geistigen Eigentums“ entgegen. Die „erhobenen Rohdaten und gewonnenen Erkenntnisse“ seien vom „Schutzbereich“ der „Wissenschaftsfreiheit erfasst“. Das PEI verweist auf Rechtsprechung, wonach Wissenschaftler „frei darüber entscheiden könnten, ob und wann sie welches Forschungsmaterial an Dritte herausgeben oder veröffentlichen wollen“.
Das Institut schlussfolgerte: „Die SafeVac-Studie stellt eine wissenschaftliche Tätigkeit in diesem Sinne dar“ und betonte in einem weiteren Schreiben sogar, „dass für die rechtliche Entscheidung, ob die begehrten Rohdaten nach dem IFG herauszugeben sind oder nicht, ein mögliches öffentliches Interesse der Bevölkerung in keiner Weise von Bedeutung ist“ (Hervorhebung im Original). Eine „Veröffentlichung der Forschungsergebnisse“ sei aber „im Laufe des Jahres 2024 geplant“ und die Daten könnten „folglich im Anschluss herausgegeben werden“.
Meyer-Hesselbarth überzeugten diese Argumente nicht. Aus ihrer Sicht handelt es sich bei den SafeVac-Erhebungen sehr wohl um Pharmakovigilanz-Daten, die weder der Geheimhaltung noch dem „Schutz ‚geistigen Eigentums‘“ unterlägen. In mehreren Entgegnungen machte sie unter anderem geltend, dass auch die Ständige Impfkommission eine aktive Überwachung „dringend angemahnt“ habe – somit handele es sich nicht um eine „frei gestaltbare ‚Forschung‘ des PEI, sondern um einen essentiellen Bestandteil der Sicherheitsüberwachung“. Ferner wies sie darauf hin, dass das PEI die SafeVac 2.0-Studie der Öffentlichkeit selbst als Teil der Pharmakovigilanz präsentiert habe.
In der Tat war im Dezember 2020 im vom PEI und Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegebenen Bulletin zur Arzneimittelsicherheit nachzulesen (S. 28): „Die geplante Befragung zur Verträglichkeit der COVID-19-Impfstoffe über die Smartphone-App SafeVac 2.0 ist Teil einer aktiven Surveillance der Impfstoffsicherheit.“ Ferner listet das PEI die SafeVac 2.0 Studie noch heute als eine seiner „aktiven Pharmakovigilanz-Studien für eine hohe Impfstoffsicherheit.“ In einem zuletzt 2024 aktualisierten FAQ schreibt das PEI, die Smartphone-App SafeVac 2.0 sei „als Teil einer Studie zur aktiven Überwachung der Sicherheit und Verträglichkeit von COVID-19-Impfstoffen entwickelt“ worden.
PEI 2024: keine Veröffentlichung wegen „technisch unerwarteter Herausforderungen“
Im Jahr 2024 – in dem laut eigener Aussage des PEI die Forschungsergebnisse eigentlich veröffentlicht werden sollten – war von einer baldigen Veröffentlichung plötzlich keine Rede mehr. Im Februar schrieb das Institut dem Gericht:
„Die Auswertung und Analyse der Studie läuft bereits, sie birgt aber aufgrund der deutlich größeren Teilnehmerzahl als erwartet und den damit verbundenen wesentlich größeren Datenmengen technisch unerwartete Herausforderungen und verursacht schlicht zeitlich einen erheblich höheren Aufwand als geplant. Es kann daher derzeit nicht verbindlich abgeschätzt werden, bis wann die Studie beendet werden wird.“
Doch die hier vom PEI geltend gemachte Überforderung mit der Auswertung der Daten wirft Fragen auf. Denn dass es ressourcenbezogene Probleme mit der Auswertung gab, war seit Jahren bekannt – und keine Erkenntnis, die sich erst im Jahr 2024 neu herauskristallisierte.
Bereits im Juni 2021 berichtete das ZDF: „Paul-Ehrlich-Institut überlastet“. Schon damals sei eine bereits „länger geplante Veröffentlichung einer Zwischenauswertung“ der SafeVac 2.0-Erhebung laut einer PEI-Sprecherin „der Vielzahl täglich eingehender Verdachtsfallmeldungen zum Opfer gefallen“. Das PEI sei „überlastet“, hieß es im (inzwischen gelöschten, aber als Archiv-Version noch abrufbaren) ZDF-Beitrag. Der damalige Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft Professor Wolf-Dieter Ludwig nannte die Situation ein „Desaster“: „Das hätte man im Vorfeld unbedingt besser organisieren müssen, dass es im PEI nicht zu solchen Verzögerungen und Kapazitätsengpässen komme – dafür seien die Daten einfach zu wichtig,“ zitierte das ZDF den Fachmann.
Die ehemalige Leiterin der Abteilung Sicherheit von biomedizinischen Arzneimitteln und Diagnostika des PEI, Brigitte Keller-Stanislawski, schilderte 2023 vor dem Corona-Untersuchungsausschuss in Brandenburg ebenfalls eine gravierende Überlastung der Behörde:
„Es gab Leute, die haben sich nur um Todesfälle gekümmert und Leute, die haben sich nur um Myokarditis gekümmert, wir hatten ja viel mehr Arbeit als zuvor, nur durch diesen Impfstoff. Wir haben aus anderen Abteilungen Hilfe bekommen, weil wir zu wenig Leute für die Bearbeitung der Impfnebenwirkungen hatten.“
Die IT-Struktur der App sei auf die Vielzahl der Meldungen nicht vorbereitet gewesen sei. Daten von den 700.000 Teilnehmern seien so noch im September 2023 „unbearbeitet“ gewesen, hieß es in einem Bericht von „Apollo News“.
Die Redaktion wollte daher vom PEI und vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) wissen, ob man sich vor diesem Hintergrund um einen Ausbau der personellen, technischen, finanziellen oder anderweitig nötigen Ressourcen bemüht habe und falls ja, mit welchem Ergebnis. Das PEI ließ die Frage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.
Das BMG stellte lediglich fest, es habe das „PEI in der Pandemie mit Finanz-Mitteln u.a. im Bereich der Pharmakovigilanz – auch konkret für die Beobachtungsstudie SafeVac 2.0 – unterstützt“ und verwies auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage eines AfD-Abgeordneten. Darin heißt es jedoch bloß, dass im „Laufe des Jahre 2021“ die für Pharmakovigilanz zuständige Abteilung des PEI von 18 Mitarbeitern (Stichtag 31. Dezember 2020) „auf 32 Mitarbeitende aufgestockt“ worden sei. „Weiteres Personal wurde flexibel aus verschiedenen Fachabteilungen des PEI eingesetzt“.
Details zu den Ressourcen für die Auswertung der SafeVac 2.0-Daten sind dort nicht zu finden, das BMG selbst verweigert auf nochmalige Nachfrage nähere Angaben zum Umgang mit der Überlastung des PEI bei der Auswertung dieser Daten.
Nur drei bis fünf Mitarbeiter zur Bearbeitung der SafeVac 2.0 Daten?
Möglicherweise liegt das daran, dass man diese Überlastung billigend in Kauf nimmt und seit Jahren keine Abhilfe schafft. In der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD vom Juli 2023 heißt es, für die „Entwicklung, Umsetzung und Auswertung“ der SafeVac 2.0 Daten seien „drei Personen zuständig“ gewesen. „Für die Registrierung, Bearbeitung und Dokumentation der berichteten Informationen waren bis zu fünf Personen beschäftigt“. Zum Zeitpunkt der Antwort auf die Anfrage sei „noch eine Person mit der Registrierung, Bearbeitung und Dokumentation der berichteten Information beschäftigt“. „Eine weitere Person“ sei damals „mit der Vorbereitung der geplanten Auswertung betraut.“ gewesen.
In einem veröffentlichen Schriftsatz des Rechtsprofessors Martin Schwab vom 1. Juli 2022 sind zudem Aussagen des PEI-Mitarbeiters Dirk Mentzer dokumentiert. Darin heißt es:
„Herr Mentzer erläuterte auf Nachfrage, das PEI beschäftige insgesamt 13 Mitarbeiter für die Erfassung der Impfkomplikationen. Oftmals handle es sich dabei um Werkstudenten.“
Martin Schwab folgerte: „Damit ist die Abteilung zur Erfassung der Verdachtsfälle nicht nur quantitativ deutlich unterbesetzt; vielmehr steht auch zu befürchten, dass die fachliche Qualifikation des Personals nicht ausreicht, um die Verdachtsfälle richtig einordnen zu können.“ Die Redaktion hakte beim BMG nach, wie viele Mitarbeiter in der Vergangenheit und aktuell mit der Auswertung der SafeVac 2.0-Daten beschäftigt waren beziehungsweise sind und ob darunter Werkstudenten seien. Das BMG ließ die Frage unbeantwortet.
Wie die Welt im Juli 2025 berichtete, sei „zuletzt aus Kreisen des PEI“ zu erfahren gewesen, dass die Lizenz der Software „zwischenzeitlich abgelaufen“ sei. „Eine Verlängerung habe man sich aus Kostengründen gespart, und für die neue Software hätten dann die programmierkundigen Mitarbeiter gefehlt.“
2025: Hat das PEI vor Gericht falsche Angaben gemacht?
Derweil wurde im Juli 2025 im Zuge einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine schriftliche AfD-Frage bekannt, dass es bei rund 0,5 Prozent der SafeVac 2.0-Teilnehmer (3506 Personen von 739.515 Teilnehmern) einen Verdacht auf schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben habe. Die „Welt“ schreibt, dieser Anteil hebe sich „drastisch“ von offiziellen Verlautbarungen ab. Der damaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei 2023 etwa von von 0,01 Prozent ausgegangen, das Robert-Koch-Institut von 0,00027 Prozent.
Der „Cicero“ rechnet vor, dass man somit – bezogen auf die Gesamtzahl aller Geimpften in Deutschland – von rund 300.000 Menschen ausgehen müsste, die möglicherweise schwerwiegende Nebenwirkungen davon getragen haben. „Schwerwiegend“ sind Nebenwirkungen laut Arzneimittelgesetz etwa dann, wenn sie tödlich enden, lebensbedrohlich sind oder zu Krankenhausaufenthalten, bleibender Behinderung oder Geburtsfehlern führen.
Die AfD hatte allerdings nicht nach „schwerwiegenden“ Fällen gefragt, sondern wie viele Verdachtsmeldungen das PEI „insgesamt“ an die EudraVigilance-Datenbank weitergeleitet hat. Dazu schreibt das BMG in seiner Antwort lediglich: „Alle Verdachtsfälle mit nicht-schwerwiegenden Ereignissen werden mit Abschluss der Auswertung der klinischen Studie an die Eudravigilance-Datenbank der EMA berichtet.“
Aus Sicht der Juristin Franziska Meyer-Hesselbarth ist das auffällig. Denn im Rechtsstreit um die Herausgabe der SafeVac2.0-Daten hat das PEI im April 2023 noch geltend gemacht, auch Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, „die im Rahmen der SafeVac-App übermittelt wurden“, seien in der EudraVigilance-Datenbank „enthalten“ und „in die fortlaufende Risikobewertung und -überwachung der Covid-Impfstoffe einbezogen“. Sollte das PEI hingegen tatsächlich erst – wie das BMG in seiner Antwort schreibt – mit „Abschluss der Auswertung“ die entsprechenden Daten melden, hätte das PEI zuvor falsche Angaben gemacht, die Daten wären demnach doch nicht in die Risikobewertung einbezogen worden. Meyer-Hesselbarth schreibt in einer Stellungnahme: „Falscher Vortrag bei Gericht ist wiederum strafbar als versuchter Prozessbetrug.“
Die Frage, wie viele Verdachtsfallmeldungen über Nebenwirkungen das Paul-Ehrlich-Institut insgesamt in Bezug auf die Teilnehmer der SafeVac 2.0-Studie an die Datenbank EudraVigilance weitergeleitet hat, lässt das PEI unbeantwortet. Allerdings macht Meyer-Hesselbarth darauf aufmerksam, dass ein „Datenanalyst“ die EudraVigilance-Daten „heruntergeladen und in auswertbarer Form ins Internet gestellt hat“. Demnach fänden sich dort „56.545 Eintragungen“ zu SafeVac 2.0-Daten. Die Juristin rechnet vor: „Auf ca. 1.18 Millionen Impfungen in SafeVac bedeutet dies, dass das PEI für ca. 4,8 Prozent der Teilnehmer PRO Impfung, eine meldepflichtige Nebenwirkung zu EudraVigilance übermittelt hat“ (Hervorhebung im Original).
Bei dieser Nebenwirkungsrate hätten entsprechend „nach der 3. Dosis 13,3 Prozent der Teilnehmer ein meldepflichtige Nebenwirkung erlebt.“ Bislang hat das PEI allerdings nicht offiziell die Frage beantwortet, ob es bisher tatsächlich 56.545 Verdachtsfallmeldungen für Teilnehmer der SafeVac2.0-App an EudraVigilance übermittelt hat. Eine entsprechende Nachfrage des Journalisten Bastian Barucker wird seit dem 17. Juni 2025 von der Behörde nicht beantwortet. Auch ein im August mit Unterstützung von Meyer-Hesselbarth angestrengtes presserechtliches Eilverfahren veranlasste das PEI nicht zu einer Beantwortung dieser eigentlich recht simplen Frage.
Brisante offene Fragen
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie Meyer-Hesselbarth zu ihrer Einschätzung kommt, das Paul-Ehrlich-Institut leiste von Ärzten begangenen Körperverletzungen Vorschub. Auf Grundlage der „Daten, die das PEI liefert“, sei keine wirkliche Aufklärung möglich. Aus juristischer Sicht, so erklärte sie während ihrem Vortrag in Bremen, würde sie Ärzten raten, ihren Patienten zu sagen, dass sie sie „nicht aufklären“ könnten, weil „die Daten, die es eigentlich gibt“, den Ärzten „nicht zugänglich gemacht werden“.
Die Geheimhaltung der SafeVac 2.0-Daten sei aber auch noch aus weiteren Gründen brisant: Möglicherweise gehe aus den Daten hervor, dass es die vom PEI geleugnete chargenbezogene Häufung von Verdachtsfallmeldungen bei Impfungen mit den Pfizer / BionTech-Präparaten eben doch gebe. Ferner könnte mit den Daten weiter bestätigt werden, dass der Bevölkerung nicht jener Impfstoff verabreicht wurde, der ursprünglich eine Zulassung erhalten hatte. Denn Pfizer nutzte im Zulassungsverfahren eine andere Herstellungstechnik als bei der späteren Massenproduktion. Dieser Umstand könnte für eine erhöhte Nebenwirkungsrate bei der breiten Anwendung des Impfstoffs in der Bevölkerung verantwortlich sein und ließe sich wohl durch Vergleich der Herstellerstudie mit der SafeVac 2.0-Studie aufdecken. Auch das Ausmaß der Untererfassung von Verdachtsfällen auf Impfnebenwirkungen wäre laut Meyer-Hesselbarth mehr oder weniger feststellbar.
Der Virologe und Epidemiologe Alexander Kekulé wies kürzlich in einem Beitrag im „Focus“ zudem darauf hin, dass es „nicht auszuschließen“ sei, dass „dass sich die – seinerzeit vom Robert-Koch-Institut bestrittene – ‚Welle der Geimpften‘ bereits im Herbst 2021 in den SafeVac-Daten abzeichnete“. Eine „rechtzeitige Auswertung“ hätte „den damaligen Verfechtern von 2G, 1G und einer allgemeinen Impfpflicht den Boden entzogen“. Kekulé bezeichnete den Umgang des PEI mit den SafeVac 2.0-Daten als „unverhohlene Hinhaltetaktik“. Er forderte die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf, „das PEI dienstlich anzuweisen, die SafeVac-Studie jetzt umgehend fertigzustellen und den Abschlussbericht auf der dafür gesetzlich vorgesehenen Plattform zu veröffentlichen“.
Das BMG zeigt sich von dieser Aufforderung unbeeindruckt. Bei der SafeVac 2.0-App handele es sich um eine „zusätzliche, freiwillige Beobachtungsstudie, die nicht gesetzlich vorgeschrieben war“, schreibt das Ministerium auf Anfrage. Es gehe um „ergänzende Erkenntnisse zur Verträglichkeit der COVID-19-Impfstoffe“. Die „gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberwachungen“ würden „durchgehend erfolgen“:
„Nach Sichtung, Konsistenzprüfung und Validierung der übermittelten Daten sind die Analysen der SafeVac 2.0-Daten gemäß Studienprotokoll inzwischen abgeschlossen. Die Ergebnisse werden aktuell für eine Publikation in einer Fachzeitschrift zusammengefasst.“
Nähere Details sind weder dem Ministerium noch dem PEI zu entlocken. Auch das Verwaltungsgericht in Darmstadt hat offenbar noch immer keine Eile, das seit 2022 laufende Verfahren um die Herausgabe der Daten zügig zu beenden. Auf Anfrage teilt das Gericht mit, es sei „nicht absehbar“, wann „mit einer Terminierung des betreffenden Verfahrens gerechnet werden kann“. Grund sei eine „Vielzahl vordringlich zu bearbeitender Klage- und Eilverfahren“, das Gericht sei überlastet. Die Pressestelle bittet um „Verständnis“ dafür, dass sie „grundsätzlich keine Bewertung der Verfahrensdauer einzelner Klageverfahren abgibt“.
Rechtsanwältin Meyer-Hesselbarth zeigt sich schockiert von der Nonchalance, mit der das PEI, das Ministerium und das Gericht den Fall behandeln. Im Gespräch sagt sie: „Das Informationsfreiheitsgesetz dient der Kontrolle behördlichen Handelns und sichert das Rechtstaatsprinzip ab.“ Im Fall der SafeVac 2.0-Daten sei diese Kontrolle besonders nötig. Denn: „Wir müssen inzwischen leider davon ausgehen, dass hier behördliche Gesetzesverstöße vorliegen.“ Das Paul-Ehrlich-Institut hätte gesetzliche Fristen wahren und die Daten längst veröffentlichen müssen, erklärt die Juristin. Sie vermutet handfeste Interessenskonflikte:
„Der Staat hat zugunsten der Impfstoffhersteller die Haftung für Impfschäden übernommen. Es liegt nahe, dass das Paul-Ehrlich-Institut die SafeVac 2.0-Daten deswegen dauerhaft unterdrücken möchte und dass die Justiz der Behörde sogar dabei hilft, indem sie sich weigert, zeitnah über die Zugänglichmachung der SafeVac 2.0-Daten zu entscheiden.“
All das rückt die Aktion „#ImpfstoffFakten gegen Mythen“ in kein gutes Licht. Der Umgang mit den SafeVac 2.0-Daten zeigt: Der im Rahmen der digitalen „Aufklärungskampagne gegen Falschinformationen“ vom PEI verkündete „Fakt“, wonach Nebenwirkungen „transparent kommuniziert“ würden, scheint eher aus einer Art Glaubensbekenntnis denn aus wissenschaftlicher Erkenntnis hervorzugehen.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 105.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 105.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: