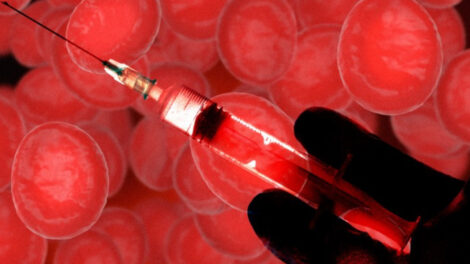Eine neue Studie aus den USA zeigt: Der Einsatz von KI beim Schreiben verändert die Hirnaktivität junger Menschen – mit möglichen Folgen für Lernen, Denken und Bildung.
von Sebastian Witte
Früher saßen Schülerinnen und Schüler über aufgeschlagenen Büchern, blätterten in Lexika, unterstrichen Absätze, um daraus mühsam ein Argument zu formen. Heute reicht ein Satz in einem Textfeld – und ChatGPT liefert innerhalb von Sekunden eine strukturierte Antwort, oft fehlerfrei, meistens flüssig abgefasst. Dass diese Bequemlichkeit etwas mit unserem Gehirn macht, mutmaßen Expertinnen und Experten schon länger.
Eine neue Studie des MIT Media Lab legt nun nahe, dass der Einsatz von Sprachmodellen wie ChatGPT das Denken nicht nur verändert, sondern messbar dämpft – zumindest bei jungen Menschen, die sich bei schulischen Aufgaben auf Künstliche Intelligenz verlassen. Die Ergebnisse, zwar noch nicht von Fachleuten beurteilt und mit begrenzter Teilnehmerzahl, werfen dennoch grundsätzliche Fragen auf: Wie wirkt sich KI auf unsere neuronale Aktivität aus? Und was steht auf dem Spiel, wenn Denken zur Delegationsaufgabe wird?
Der Versuch, Denken zu messen
Die Forscherinnen und Forscher um die Neurotechnologin Nataliya Kosmyna rekrutierten 54 junge Erwachsene zwischen 18 und 39 Jahren aus dem Raum Boston. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt: Die eine verfasste Aufsätze (wie sie in den USA lange Zeit zur Hochschulzulassung üblich waren) ohne Hilfsmittel, die zweite durfte Google zur Recherche verwenden, die dritte nutzte ChatGPT. Während des Schreibprozesses wurde die neuronale Aktivität per EEG in 32 Hirnregionen aufgezeichnet.
Das Ergebnis: Die Gruppe, die ChatGPT verwendete, zeigte durchgängig die geringste Hirnaktivität. In den EEG-Daten der Probanden fehlten jene Muster, die mit Aufmerksamkeit, kognitiver Kontrolle und semantischer Verarbeitung assoziiert sind – insbesondere in den sogenannten Alpha-, Theta- und Delta-Frequenzbändern. Die Aufsätze dieser Gruppe ähnelten sich stark, setzten auf wiederkehrende Formulierungen und galten den bewertenden Englischlehrern als “seelenlos”.
Noch auffälliger: Im Verlauf der Studie griffen die Teilnehmenden dieser Gruppe zunehmend zum Copy-Paste-Prinzip; sie ließen ChatGPT ganze Aufsätze schreiben, statt selbst zu formulieren. Als sie gebeten wurden, ihre Texte ohne KI-Hilfe zu überarbeiten, erinnerten sie sich kaum an deren Inhalte. In den EEGs zeigte sich: Wenig war kognitiv verankert worden.
Was macht das mit einem sich entwickelnden Gehirn?
Kosmyna ist besorgt: “Ich befürchte, dass politische Entscheidungsträger in naher Zukunft KI-Anwendungen in Schulen einführen, ohne deren Auswirkungen zu kennen”, sagte sie dem “Time Magazine”. Besonders das kindliche und jugendliche Gehirn seien gefährdet.
Auch der Psychiater Zishan Khan, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, warnt: “Aus psychiatrischer Sicht sehe ich, dass eine übermäßige Abhängigkeit von LLMs (Large Language Models) unbeabsichtigte psychologische und kognitive Folgen haben kann.” Es gehe um nicht weniger als die Ausbildung jener neuronalen Verbindungen, die für Gedächtnis, kreative Problemlösung und kognitive Resilienz entscheidend seien.
Die Studie ist in ihrer Aussagekraft begrenzt. Und doch ist sie eine der ersten, die mithilfe direkter Hirnstrommessung zeigt: Der Einsatz von KI kann zu messbar geringerer geistiger Aktivität führen. Die damit verbundene These lautet: Wer kognitive Prozesse auslagert, bildet sie seltener selbst aus.
Denken outsourcen – oder neu gestalten?
Neurobiologisch gesehen ist das plausibel. Tiefes Lernen, so zeigen zahlreiche Studien, hängt mit der Aktivierung des präfrontalen Cortex und dem Aufbau semantischer Netzwerke im Langzeitgedächtnis zusammen. Besonders Alpha- und Theta-Wellen gelten als Marker für kreative Ideenfindung und Bedeutungsverarbeitung. Wer Informationen nur übernimmt, ohne sie aktiv zu verarbeiten, aktiviert weniger dieser Prozesse und verankert weniger.
Doch die Sache ist komplexer. Dieselbe Studie zeigt: Eine Gruppe, die zunächst selbst geschrieben hatte und erst später ChatGPT verwenden durfte, profitierte kognitiv. Die Hirnaktivitäten stiegen im Lauf der Aufgaben, die Probanden zeigten eine stärkere Identifikation mit ihren Texten, höhere Zufriedenheit – und eine bessere Integration von KI-Ergebnissen ins eigene Denken.
Die entscheidende Variable scheint also nicht die Technik zu sein, sondern die Art der Nutzung. Wer sich von ChatGPT bedienen lässt, statt es als Impulsgeber oder Sparringspartner zu nutzen, riskiert Denkfaulheit. Wer jedoch reflektiert damit arbeitet, kann vom Perspektivwechsel, der strukturellen Klarheit oder der sprachlichen Präzision profitieren, ohne den eigenen Geist zu entmündigen.
Zwischen Effizienz und Bildung
Die Frage, wie wir lernen, ist nicht nur eine pädagogische, sondern zunehmend eine politische. In einer Zeit, in der Bildungsinstitutionen KI-Tools integrieren wollen – von automatisierten Aufsatzassistenten bis zu personalisierten Lernumgebungen – braucht es eine klare Vorstellung davon, was Lernen eigentlich leisten soll. Ist das Ziel, Aufgaben effizient zu erledigen? Oder geht es darum, Denkprozesse zu fördern, geistige Ausdauer zu stärken, Sinn zu formen?
Kosmyna plädiert für Vorsicht. Sie fordert eine gesetzliche Regulierung und eine breite Aufklärung über die Wirkmechanismen dieser Systeme. “Das Gehirn entwickelt sich analog”, sagt sie. Und es tut das vor allem durch Herausforderung – nicht durch Automatisierung.
Klar ist: Künstliche Intelligenz verändert unsere Arbeit, unsere Sprache, unser Lernen grundlegend. Doch wie bei jeder großen technologischen Umwälzung hängt ihr Wert davon ab, wie wir mit ihr umgehen. Wer seine geistige Arbeit dauerhaft an Maschinen delegiert, riskiert mehr als nur intellektuelle Trägheit. Er verzichtet auf das, was menschliches Denken im Kern ausmacht: die Fähigkeit zur Verknüpfung, zum Fragen, zum Zweifeln – und zur schöpferischen Antwort. Oder, wie es die Probanden der Studie ungewollt gezeigt haben: Nur wer selbst denkt, kann sich später daran erinnern.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 107.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 107.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: