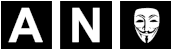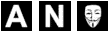So weit drang noch kein Ausländer vor: Eine Expedition in den äußersten Norden Sibiriens ist nichts für Anfänger. Zwischen Birken und Borschtsch birgt die Reise anfangs nur begrenzte Sinnesfreuden. Doch bald schon kommt der Moment, in dem das Eis schmilzt – trotz klirrender Kälte.
von Kolja Spöri
Schlafendes Land – so tauften tatarische Reiternomaden ihr Sibir. Unter Permafrost schlummert es, zwanzig Mal so groß wie die Bundesrepublik. Vom ewigen Eis für immer verschluckt wurden Steppenvölker wie die Skythen, ausgestorbene Tierarten wie Wollmammuts und unerforschte Erreger wie das Mollivirus.
Die wahren Talente der Russen: improvisieren, Kälte und Schmerz ignorieren.
Nach 30.000 Kilometern von Murmansk über Moskau nach Magadan lodert in mir noch ein Lebenstraum: die eisige Anabar-Route zum nördlichsten Straßenende der Welt zu fahren, als einer der ersten Ausländer – die ultimativ coolste Sackgasse, noch weiter nördlich als das Nordkap in Norwegen. Die Anabar ist ein Zimnik, eine der legendären russischen Winterstraßen, die jedes Jahr zwischen Dezember und März von Staats wegen neu präpariert werden, mit Schneeraupen und Bulldozern, um die entlegensten Winkel für die Versorgung der Bevölkerung zugänglich zu machen – und zur Erschließung von Öl-, Gas- und Goldvorkommen.

Wir, das Expeditionsteam, sind drei Germanen der Generation Google Earth. In Irkutsk besteigen wir unseren Geländewagen – einen russischen Lada. Sibiriens bekannteste Stadt gehört mit 600.000 Einwohnern noch nicht einmal zu den zwanzig größten in Russland. Sie ist am berühmten Baikalsee gelegen, dem tiefsten und ältesten Süßwasserreservoir der Erde.
Eiseskälte und echte Männer
Die Einfahrt in die kalte Hölle beginnt für uns hinter Ust-Kut, dem Verbannungsort von Leo Bronstein, genannt Trotzki, der ironischerweise nicht hier, sondern vierzig Jahre später im warmen Mexiko verstarb. An einem Eispickel in seinem Schädel – mit Grüßen von Stalin. Bei Werchnemarkowo hört die asphaltierte Ganzjahresstraße plötzlich auf, und es beginnt die Winterpiste zu den gigantischen Talokan-Gasfeldern von Gazprom. Auf den nächsten 1.000 Kilometern gibt es weder Tankstellen noch Polizisten, kein Handynetz, keine Frauen und keine Genderbeauftragten. Hier überleben nur beinharte Zimnik-Trucker.
Hier wurde 1974 eine Atombombe gezündet.
Manche der professionellen Fernfahrer haben einen Hochschulabschluss und verdienen in den drei Wintermonaten genug für den Rest des Jahres. Andere haben Knast-Tätowierungen und genießen die ungesiebte Luft. Jeder hilft hier jedem, das ist das ungeschriebene Gesetz der Taiga. Alle fünfzig Kilometer steht ein Lkw quer, dreht trotz Schneeketten am Berghang durch oder hängt in einer Schneeverwehung über Kopf. Bei diesen Malheuren entfalten sich die wahren Talente der Russen: improvisieren, Kälte und Schmerz ignorieren und so den Karren gemeinsam aus dem Dreck ziehen.
Unser Fahrzeug ist ein nagelneuer Lada Niva, gestellt vom Edelweiß Judo Club in Grosny, immerhin mit Sitzheizung und automatischen Fensterhebern, aber ohne ESP und ABS. Daran muss man sich als elektro-humanoides Hybridwesen erst einmal wieder gewöhnen. Dennoch kommen wir deutlich besser durch als die großen Jungs, driften bisweilen mit Tempo 100 durch den vereisten Wald. Dann folgen tückische Buckelpisten, auf denen 30 km/h das höchste der Gefühle sind. Unfreiwillige Wartepausen hinter festsitzenden Sattelschleppern muss man in Kauf nehmen. Zwingend ist das gelegentliche Nachtanken unseres versoffenen kleinen SUVs aus den sechs Benzinkanistern im Kofferraum. Das Quecksilber pendelt sich Anfang März gnädig zwischen minus 25 und minus 45 Grad Celsius ein. Selbst 60 Grad unter null sind hier nicht ungewöhnlich. Pipi erstarrt dabei nicht sofort zur Eissäule, nur bei größeren Geschäften friert einem buchstäblich das Achterdeck ein. Da heißt es «davai, davai!» – los, los!
Die Juwelen Sibiriens
Nach zwei Tagen und einmal «Atemlos durch die Nacht» (Helene Fischer wurde unweit im schönen Krasnoyarsk geboren) erreichen wir die Republik Jakutien und eine größere Stadt mit beheizten Hoteltoiletten: Mirny, zu Deutsch: Frieden, hat knapp 40.000 Einwohner, davon sind gut die Hälfte Frauen. Hauptattraktion: Eines der gewaltigsten Bohrlöcher der Erde, über 500 Meter tief. Bis heute wurden hier Diamanten im Wert von 17,5 Milliarden US-Dollar herausgeholt. Genau wie früher wird auch heute die ganze Steinschneiderei vom Staat gelenkt – und von einer Sperrminorität des Oppenheimer-Clans kontrolliert. Den Menschen, die hier in der Kälte leben und arbeiten, geht es gut, trotz allem. Wladimir Putins wirtschaftlichen Aufschwung kann man bis in die letzten Winkel seines Riesenreichs beobachten.

Nach 500 kerzengeraden Kilometern gen Norden erreichen wir die nächste Stadt. Udatschny bedeutet auf Deutsch Glück. Der Lebensstandard der etwa 13.000 Einwohner ist angemessen. Trotz der Abgeschiedenheit gibt es hier alles Lebensnotwendige zu kaufen. Die Fassaden der Wohnhäuser hat man bunt gestrichen, um die Tristesse der Plattenbauten etwas erträglicher zu machen. In Udatschny wurde tatsächlich einmal eine Atombombe gezündet, damit der Kraterausbau vorankommt. Das war 1974. Hundert Meter tiefer als in Mirny funkeln auch jetzt noch eine Menge roher Diamanten.
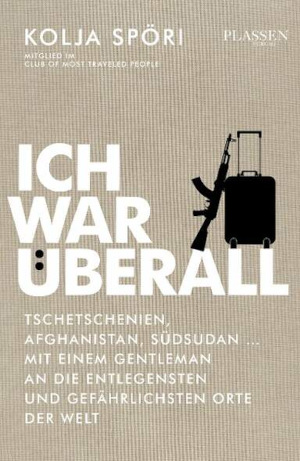
Etwa 30 Kilometer hinter der Stadt, im Sommer unerreichbar, markiert ein jakutischer Totempfahl den Polarkreis, bei 66 Grad nördlicher Breite. Abergläubische Besucher hängen bunte Tüchlein und Zettelchen an ihm auf. Daneben steht ein Schamanenzelt und ein kreisförmiges Blechschild mit der Aufschrift «Polyarny Krug». Wir genießen an diesem Tag tadelloses Zarenwetter. Es ist ein Schweben wie auf Watte durch einen verschneiten Märchenwald. Auf unserer Reise treffen wir Oleg, einen einsamen Eremiten mitten im Niemandsland, der uns in seiner Holzhütte einen herzhaften Borschtsch und köstliches Gulasch kocht. Unser einziges warmes Essen auf über tausend Kilometern Anabar-Straße, an das wir noch lange zurückdenken…
Wir schaffen wegen besonderer Buckeligkeit und einigen Ausrutschern auf der Waldpiste nur 350 Etappenkilometer bis Olenjok, einem pittoresken Nest mit 2.200 Einwohnern. Übernachtet wird in einem ordentlichen kleinen Gasthaus, einer Gostinitza. Am nächsten Tag erreichen wir den knapp tausend Kilometer langen Fluss, welcher der Anabar-Straße den Namen gibt. Auf seinem glattgefrorenen Eis kurven wir deutlich zügiger als im hubbeligen Wald. Von drei Ortschaften, die wir passieren, sind zwei seit Gorbatschow von allen guten Geistern verlassen. Man möchte hier keine Panne haben. Unser Iridium-Telefon beruhigt. Einmal beobachten wir Diamantschürfer, die mit Spitzhacke und Schaufel in einer Flussbiegung nach glitzernden Steinen suchen. Ein anderes Mal entzückt uns ein süßer kleiner Zobel am Wegesrand. Dieses Tier trägt die Hauptschuld für die frühe Besiedlung Sibiriens, obwohl ihm immer nur das Fell über die Ohren gezogen wurde.
Die kälteste Sackgasse der Welt
Wir fressen ordentlich Kilometer, über 600, und erreichen spätabends die Distrikthauptstadt Saskylach mit ihren 2.300 Einwohnern. Benzin ist hier streng rationiert, weil die Versorgung so beschwerlich ist. Der kompetente Gouverneur Ewgeny lässt uns dennoch alle Kanister bis zum Anschlag befüllen. Zwei freundliche Uniformträger vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB prüfen unsere Sondergenehmigung, den sogenannten Propusk, den wir für das arktische Grenzgebiet zwingend im Voraus beantragen mussten, und Slawa, der Mechaniker, flickt kleine Macken an unserer russischen Rennsemmel. Alle versichern uns, dass wir die ersten Ausländer seien, die mit einem normalen Auto bis hier hoch gefahren sind.

Unsere bescheidene Herberge hat kein fließend Wasser, nur riesige Eiswürfel aus dem Fluss, die im Wohnzimmer in Fässern aufgetaut werden. Selbst der Fisch wird hier gefroren in kleine Streifen gehobelt, das nennt sich Muksul – und schmeckt wunderbar! Nach einem guten Frühstück nehmen wir die letzte Etappe nach Norden auf uns, knapp 250 Kilometer bis zum Laptew Meer, dem arktischen Ozean, der um diese Jahreszeit natürlich bis zum Nordpol gefroren ist. Entlang des Anabar wechselt die Landschaft nun schlagartig von leicht bewaldeter Taiga über baumlose Tundra in eine unwirtliche polare Traumwelt. Unter unseren Reifen knarzt pures Eis. Am Ende der Straße erreichen wir Yuryung-Khaya, wo knapp 1.000 Dolganen, eine turksprachige Minderheit, von der Rentierzucht leben. Beim Blick auf die GPS-Daten liegen wir uns in den Armen, knipsen Beweisfotos, dann killt die brutale Kälte die Batterien unserer Kameras.
Als nächstes fahren wir uns so unglücklich im getauten Schnee fest, dass wir stundenlang auf Hilfe warten müssen. Auf der offenen Ladefläche des zur Rettung geeilten Abschleppwagens sind hunderte gefrorene Rentierkeulen gestapelt, fertig zum Export. Ein surreales Bild. Mehrere Bergegurte und Geduldsfäden reißen, bis der Lada endlich wieder frei ist. Inzwischen ist die Nacht hereingebrochen, die geplante Rückfahrt nach Saskylach ausgeschlossen, und kein Anwohner will uns Fremde in sein warmes Haus lassen. Bei minus 45 Grad zeigt man uns buchstäblich die kalte Schulter.
Nur die Harten
Vor dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn Anfang des 20. Jahrhunderts war das sumpfige Land, das vor uns lag, nur im Winter zu durchqueren: auf der sogenannten Steppenautobahn, über zugefrorene Flüsse und Seen, mit Pferden, Schlitten und auf Schusters Rappen. Über zehntausend Kilometer Eis hinweg bezwangen so ab dem 16. Jahrhundert die ersten weißen Fernhändler die endlose Weite: Haudegen wie der Kosake Jermak, Forscher wie der deutsche Johann Georg Gmelin oder Verbannte wie Fjodor Dostojewski und zuletzt Kriegsgefangene wie der Deutsche Clemens Forell (verewigt im Roman So weit die Füße tragen).
Wir müssen auf die späte Rückkehr des Bürgermeisters vom Eisangeln warten, einem freundlichen Kasachen, der uns im leicht verlotterten Lagerraum des Postamtes nächtigen lässt. Früh am nächsten Morgen beginnt unsere lange, lange Heimreise: noch einmal 4.000 Kilometer zurück aus der einsamsten, der nördlichsten, der kältesten Sackgasse der Welt. Dann acht Zeitzonen per Flugzeug, immer nach Westen, im Rücken ein Land aus Eis und Feuer, das lebt und sich selbst genügt.
Kolja Spöri (* 1969) ist Weltenbummler, Abenteurer und Buchautor. Zunächst Sponsoring-Manager von Hugo Boss, arbeitet er 20 Jahre lang als Formel-1-Experte und beteiligte sich unter anderem am TV- und Pressezentrum des Fürstenhauses von Monaco. Spöri ist Dozent der Fakultät des IOC an der Universität Lausanne, Präsident des Extremreisen-Kongresses ETIC und Autor des Reisebestsellers «Ich war überall: Tschetschenien, Afghanistan, Südsudan–Mit einem Gentleman an die entlegensten und gefährlichsten Orte der Welt», erschienen 2014 im Plassen Verlag (320 Seiten, 19,99 Euro)
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 103.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 103.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: