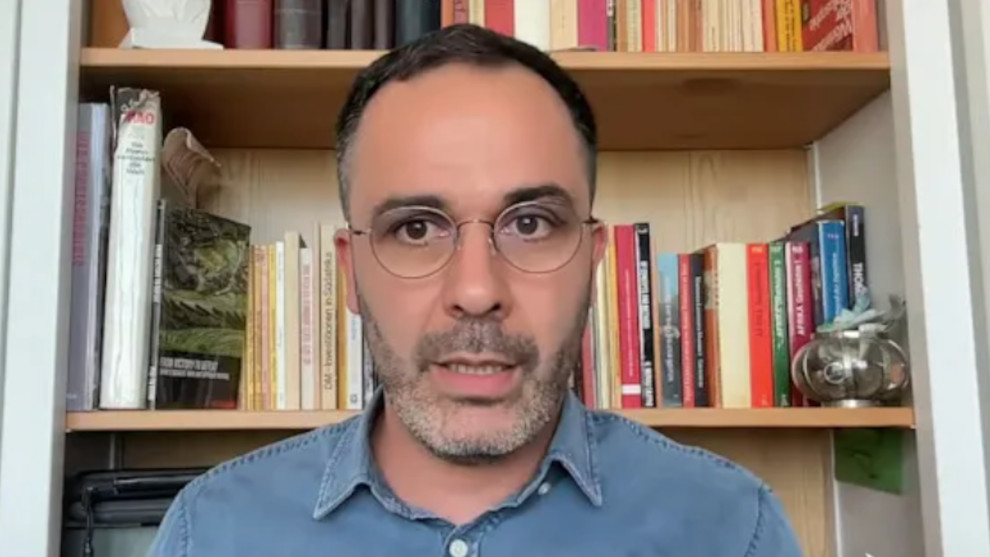Der deutsche Staatsbürger Hüseyin Dogru landete auf einer EU-Sanktionsliste gegen Russland. Wer herausfinden will, warum der deutsche Journalist nun vom Zahlungsverkehr und einem normalen Leben abgeschnitten wird, stößt auf ein Geflecht aus „geheimen Beweisen“ und öffentlichen Verdächtigungen. Für oppositionelle Medien wird es in der Europäischen Union ernsthaft gefährlich.
von Lena Böllinger
Die Europäische Union (EU) listet in ihrem 17. Sanktionspaket gegen Russland vom 20. Mai auch den Journalisten Hüseyin Dogru und das Onlinemedium „red.“ auf. Dogru war Gründer und Chefredakteur des inzwischen eingestellten Mediums. Er ist deutscher Staatsbürger und lebt mit seiner Frau und seinem Kind in Deutschland. Seine Frau ist zudem im siebten Monat schwanger mit Zwillingen.
Die Sanktionierung durch die EU bedroht die Familie existenziell: Wie die Zeitung „Junge Welt“ berichtete, seien Dogrus Konten von einem Tag auf den anderen gesperrt worden – plötzlich hätten die Bankkarten nicht mehr funktioniert. Er sei vorab nicht informiert worden. Auf X schrieb er, es sei ihm nicht erlaubt, seinen Anwalt und seine Miete zu bezahlen. Es sei ihm nicht einmal gestattetet, Geschenke anzunehmen. Er dürfe weder Zahlungen tätigen noch empfangen.
Das umfasst auch die Lohnarbeit: Die Zeitung „Junge Welt“ hatte überlegt, Dogru anzustellen – womit sie sich aber strafbar machen würde. Einer sanktionierten Person „dürften keinerlei wirtschaftliche Vorteile mehr zugute kommen“, erklärte der Leiter des Referates für Sanktionsdurchsetzung im Bundeswirtschaftsministerium der Zeitung. Faktisch bedeutet die Sanktionierung also ein Berufsverbot gegen den Journalisten. Dogru erläutert auf X, bei Zuwiderhandlung drohten ihm mindestens fünf Jahre Haft. Auch eine Betätigung im Ausland sei nicht möglich, denn er dürfe das Land nicht verlassen.
Sogar seiner Frau sei das Bankkonto gesperrt worden, sie habe ihren Lohn nicht empfangen können, obwohl sie nicht sanktioniert wurde. Wie es im Bericht der „Jungen Welt“ heißt, habe die Deutsche Bundesbank das auf Nachfrage als Fehler bezeichnet. Gegenüber der Redaktion äußerte sich die Bundesbank „aus Gründen des Vertraulichkeitsschutzes“ nicht zur Kontosperrung seiner Frau. Die Bundesbank erklärt aber, dass „zum Beispiel“ gemäß der entsprechenden EU-Verordnung, „die nationale zuständige Behörde die Freigabe eingefrorener Gelder oder die Bereitstellung bestimmter Gelder genehmigen kann, wenn sie festgestellt hat, dass die betreffenden Gelder zur Befriedigung der Grundbedürfnisse“ „notwendig“ seien.
Dazu gehörten „etwa Nahrungsmittel, Mieten oder Hypotheken, Medikamente und medizinische Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen“. In welchem Umfang Gelder freigegeben würden, hänge „von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab“. „Als Orientierungsmaßstab können die Regelbedarfssätze nach dem SGB II (Bürgergeld) herangezogen werden.“ Im Bericht der „Jungen Welt“ heißt es, Dogru zufolge könne die Genehmigung bis zu zwei Wochen dauern. Anfang Juli machte Dogru schließlich öffentlich, dass die Familie wegen eingestellter Zahlungen Probleme mit der Krankenversicherung habe – was das Leben der ungeborenen Zwillinge gefährde. Wie lange die Sanktionen andauern, weiß Dogru eigenen Angaben zufolge nicht, ebenso wenig, wie viel Zeit der Rechtsweg dagegen in Anspruch nehmen wird.
Was hat Dogru verbrochen?
Was hat Hüseyin Dogru verbrochen, dass die Regierungen der Europäischen Union ihm kollektiv eine solche – für einen in Deutschland lebenden deutschen Staatsbürger bislang beispiellose – Behandlung zuteil werden lassen? Liest man in der EU-Sanktionsliste nach, in der Dogru und „red.“ auftauchen, findet man erstaunliche Ausführungen. „red.“ und Dogru sind nicht wegen ihrer Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine auf der EU-Sanktionsliste gegen Russland gelandet. „red.“ betont auf seiner Webseite sogar, seine Haltung gegenüber Russland sei „klar dokumentiert“: Russland sei „wie die USA, China, die EU oder die NATO“ „eine imperialistische Macht“, die ihre eigenen geopolitischen Interessen verfolge. „red.“ lehne „jede Form militärischer Aggression“ ab: „Wir haben den Überfall auf die Ukraine öffentlich kritisiert, über die Repression gegen Oppositionelle in Russland berichtet und stets betont, dass es sich um einen Krieg zwischen zwei imperialistischen Blöcken handelt“. „red.“ verweist beispielhaft auf einen eigenen Beitrag über den linken, oppositionellen Soziologen und Kriegsgegner Boris Kagarlitsky, der in Russland verhaftet und wegen „Rechtfertigung von Terrorismus“ zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde.
Es ist kaum logisch nachvollziehbar, einen Journalisten oder ein Medium für eine derartige Berichterstattung auf eine Sanktionsliste gegen Russland setzen zu wollen. Das scheint auch der EU klar zu sein. Folgerichtig bedient sie sich einer anderen Argumentation: Sie begründet die Sanktionierung von „red.“ und Dogru mit deren Berichterstattung im Kontext des Kriegs in Gaza: Es soll während einer „gewaltsamen Besetzung einer Universität in Deutschland durch anti-israelische Randalierer“ „Absprachen zwischen RED und den Besetzern“ gegeben haben. Ziel sei es gewesen, „Bilder des Vandalismus“ zu verbreiten, auf denen „auch Hamas-Symbole“ zu sehen gewesen seien. „red.“ habe den Besetzern eine „exklusive Medienplattform“ geboten und „den gewaltorientierten Charakter des Protests“ erleichtert.
Vermutlich nimmt die EU hier Bezug auf die Ausschreitungen an der Humboldt-Universität in Berlin im Mai 2024, über die nicht nur „Red.“, sondern auch die Berliner Zeitung berichtet hatte. Ihr Reporter vor Ort wurde von der Polizei misshandelt, ein Polizist musste später eine Geldstrafe zahlen. Die Polizeigewalt erwähnt die EU allerdings nicht.
Stattdessen wirft sie „red.“ generalisiert vor, „systematisch falsche Informationen über politisch kontroverse Themen“ verbreitet zu haben. „red.“ habe absichtlich „unter seinem überwiegend deutschen Zielpublikum ethnische, politische und religiöse Zwietracht“ säen wollen, „unter anderem durch die Verbreitung der Narrative über radikalislamische terroristische Gruppierungen wie die Hamas“. Die EU schlussfolgert daraus, Dogru unterstütze „Handlungen der Regierung der Russischen Föderation, die die Stabilität und Sicherheit in der Union und in einem oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten untergraben und bedrohen“. Dazu gehöre auch die indirekte Unterstützung oder Erleichterung gewaltsamer Demonstrationen und die „koordinierte Informationsmanipulation“.
Neben der Berichterstattung über – je nach Lesart „pro-palästinensische“ oder „anti-israelische“ – Proteste begründet die EU die Sanktionen damit, dass „red.“ beziehungsweise das Mutterunternehmen „AFA Medya A.S.“ „enge finanzielle und organisatorische Verbindungen zu Organisationen und Akteuren der Staatspropaganda in Russland“ habe. Das Medium verfüge über „tiefe strukturelle Beziehungen zu Einrichtungen der staatlichen russischen Medien“. Es soll „Verbindungen zwischen einzelnen Mitarbeitern“ und „Personalrotationen zwischen diesen Einrichtungen“ geben. Einen Nachweis für die Vorwürfe enthält die Sanktionsliste nicht, weshalb die Redaktion bei der Bundesregierung nachfragte, welche konkreten Belege für die Anschuldigen vorlägen.
Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes teilte auf Anfrage mit, die Bundesregierung habe „in einem Attribuierungsverfahren festgestellt, dass Russland hinter der Medienplattform Red. steht.“ „red.“ sei „eingesetzt“ worden, um in Deutschland „Debatten zu manipulieren und so die Gesellschaft gezielt zu spalten“. „red.“ gebe sich als Plattform unabhängiger Journalisten aus. Den Nutzern werde „verschwiegen“, dass „red.“ „personell und finanziell eng mit dem russischen Staatsmedium und Propagandainstrument RT verzahnt“ sei. Auf der Bundespressekonferenz am 2. Juli erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes zudem, Russland nutze Plattformen wie „Red.“, „um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und Europa zu schwächen“. Staatliche Strukturen würden „diskreditiert oder als nicht handlungsfähig dargestellt“. Der Sprecher resümierte:
„So wie wir gemeinsam mit unseren Partnern gegen diejenigen vorgehen, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wirtschaftlich begünstigen, so gehen wir auch gegen diejenigen vor, die im Netz systematisch Desinformationen verbreiten; denn auch das gefährdet unsere Sicherheit, und dagegen verteidigen wir uns.“
Keine Details zur Beweisführung
Der Frage nach den konkreten Beweisen weicht die Bundesregierung aus. Auf der Bundespressekonferenz erklärte der Sprecher des Auswärtigen Amtes lediglich, Grundlage des „nationalen Attribuierungsverfahres“ sei „eine umfassende Analyse der deutschen Sicherheitsbehörden“. „Gemeinsam mit unseren EU-Partnern haben wir die Hintermänner von „red.“ mit Sanktionen belegt“, sagte er. Deutschland scheint also maßgeblich an der EU-Sanktionierung des eigenen Staatsbürgers beteiligt gewesen zu sein. Weitere Details zur Beweisführung wurden auch auf Nachfrage nicht genannt. Es handele sich um „alle möglichen Erkenntnisse – auch ganz viele Erkenntnisse, die öffentlich einsehbar sind“, so der Sprecher des Auswärtigen Amtes.
Auch Anitta Hipper, Sprecherin der EU-Kommission für Außen- und Sicherheitspolitik erklärte auf Anfrage, die „Bewertung der Aktivitäten von Herrn Dogru“ seien „gründlich und wohlbegründet“. Man weise die „Behauptung“ zurück, dass seine Aufnahme in die Sanktionsliste auf „Spekulation“ beruhe. Für eine solche Entscheidung würden „Beweispakete“ zusammengestellt, für die eine „substantielle Menge an Informationen“ analysiert werde. Typischerweise würden diese Unterlagen auf ein „vielfältiges Quellenspektrum“ zurückgreifen. Der „Jungen Welt“ sagte die Sprecherin zudem, „Beweise“ würden „nur an die gelistete Person oder ihren gesetzlichen Vertreter weitergeleitet“. Relevant seien „sowohl öffentlich zugängliche als auch geheime Beweise“, über die sie keine Auskunft geben dürfe.
Die Zeitung berichtete, dass Dogru und seine Anwälte inzwischen Akteneinsicht erhalten hätten. Laut Dogru seien dort „keine geheimen Beweise“ zu finden. Auf einer Veranstaltung Anfang Juli berichtete der Journalist Florian Warweg von den „Nachdenkseiten“, Dogru habe ihm mitgeteilt, die Akten enthielten zwei vermeintliche „Belege“, die den Vorwurf der „Spaltung der bundesdeutschen Gesellschaft“ untermauern sollen. Zum einen werde Dogru ein X-Post zur Last gelegt, in dem er gesagt haben soll, er halte die DDR für den besseren deutschen Staat. Zum anderen habe er gesagt, für ihn sei der Krieg in der Ukraine „ein Kampf zwischen zwei imperialistischen Blocks“. Diese Aussagen seien die Grundlage dafür, „dass man gesagt hat, der Dogru versucht die bundesdeutsche Gesellschaft zu spalten“. In einem Telegram-Post von „red.“ Anfang Juli heißt es, die Akten enthielten „kein einziges Wort über Verbindungen nach Russland“. Die Akten würden „beweisen“, dass das Auswärtige Amt „lügt“.
Unsere Redaktion fragte die im Bundestag vertretenen Oppositionsparteien AfD, Grüne und Linke sowie zusätzlich FDP und BSW, ob sie von weiteren Beweisen wüssten. Lediglich Sevim Dagdelen vom BSW antwortete, ihr lägen keine Beweise vor. Auch über die angebliche russische Finanzierung des Mediums gebe es aus ihrer Sicht „keine verifizierbaren Quellen“. Die entsprechende Einstufung scheine allein aufgrund von „Geheimdienstinformationen“ zustande gekommen zu sein. Es sei „nicht nachprüfbar, wie verlässlich diese Informationen sind“, so Dagdelen.
Die Rolle des „Tagesspiegels“
Wer sich auf die Suche nach öffentlich verfügbaren Beweisen macht, stößt schnell auf Berichte des Berliner „Tagesspiegels“. Im Juni 2024 veröffentlichte die Zeitung einen Artikel unter der Überschrift: „Verbindungen nach Moskau? Wer hinter den Videos von den Protesten gegen Israel steckt“. Im Artikel heißt es, mehrere Videos der Proteste seien von „red.s“ Instragram-Account als sogenannte ‚Handshake‘-Posts abgesetzt worden. Derselbe Beitrag sei demnach von mehreren Kanälen gleichzeitig veröffentlicht worden, unter anderem dem der „Student Coalition“, die als „eine der maßgeblichen Koordinatorinnen der pro-palästinensischen Proteste an Berliner Hochschulen gelte“. Aus diesem Posting-Verhalten schlussfolgert der Tagesspiegel, es müsse eine „Absprache“ gegeben haben.
Der Zeitung schreibt weiter, sie sei bei ihren Recherchen auf eine „Spur zu einem russischen Propagandanetzwerk“ gestoßen. Die „Recherche“ scheint sich allerdings auf einen Tipp aus staatlichen Quellen zu beschränken. Die Zeitung habe erfahren, dass „deutsche Sicherheitskreise“ davon ausgehen würden, „red.“ sei ein „Nachfolger“ der Videoplattform „Redfish“. Der Tagesspiegel schreibt weiter, „Redfish“ habe zu „Russlands Staatsmedien rund um den Sender RT“ gehört. „Redfish“ sei eingestellt worden, um die Abwicklung habe sich Dogru gekümmert. Kurz darauf habe „red.“ den Telegram-Kanal von „Redfish“ übernommen. Dies wertete der Tagesspiegel als „Hinweis darauf, dass es sich offenbar um die Fortführung des alten Projekts unter neuem Namen handeln könnte“.
Die Untersuchung des Tagesspiegels förderte also das gleichzeitige Posten mehrerer Videos, nicht weiter belegte Annahmen deutscher Sicherheitskreise sowie die Übernahme eines Telegramkanals zutage. Das sind allenfalls Hinweise aber keine Beweise, schon gar nicht für ein Verbrechen, das mit Berufsverbot, Kontosperrung und Reiseverbot zu ahnden wäre.
Das US-Außenministerium äußert sich
Doch wenige Monate später, im September 2024, nahm erstaunlicherweise niemand geringeres als das US-Außenministerium Bezug auf die Veröffentlichung der Berliner Tageszeitung und verlieh den Hinweisen weiteres Gewicht. Die Behörde publizierte eine Pressemitteilung, in der es heißt, „verdeckte Einflussnahme“ sei „kein Journalismus“, „red.“ sei ein „Nachfolger“ von „Redfish“ und „RT“ betreibe das Medienprojekt in Deutschland „verdeckt“. In einem Pressestatement bekräftigte der damalige US-Außenminister Antony Blinken die Vorwürfe. Die US-Pressemitteilung erwähnte zudem ausdrücklich die Berichterstattung des „Tagesspiegel“, derzufolge „Red an der Organisation von Protesten in Deutschland teilgenommen hat“.
Der Tagesspiegel berichtete am nächsten Tag, die USA sähen das „Medium ‚Red‘ als Werkzeug des Kremls“. Die Zeitung wies darauf hin, dass sich das US-Außenministerium „ausdrücklich auf die Recherchen des Tagesspiegels“ beziehe. Auch die „taz“ berichtete in der Folge, dass „laut dem US-Außenministerium“ die Plattform „Red“ „im Verborgenen“ von „RT“ betrieben werde und verwies auf „mögliche Verbindungen von Red nach Moskau“, über die der Tagesspiegel berichtet habe. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe der „taz“ außerdem mitgeteilt, „red.“ sei der Behörde bekannt, „ebenso die personelle und inhaltliche Überschneidung zu Redfish“.
Kurz vor Veröffentlichung des 17. Sanktionspakets berichtete das staatlich finanzierte Medienunternehmen „Correctiv“, es habe Einsicht in die geplanten Sanktionen erhalten, diese würden sich gegen „in Deutschland tätige Propagandisten“ richten. Wer genau „Correctiv“ Einblick in die geplante Sanktionsliste gewährt hat, bleibt offen. Möglicherweise sind es jene „deutschen Sicherheitskreise“, die auch schon dem Tagesspiegel den Tipp mit der „Spur“ nach Russland gaben.
„Red.“ selbst bestreitet, von Russland finanziert zu sein. Auf der Webseite heißt es, es gebe zwar personelle Überschneidungen zwischen Mitarbeitern von „red.“ und ehemaligen „Redfish“-Mitarbeitern. Allerdings handele es sich bei den beiden Plattformen um „zwei verschiedene Unternehmen“. „Red.“ sei ein „unabhängiges Unternehmen“. Auf der Bundespressekonferenz am 2. Juli postulierte sogar der Sprecher des Auswärtigen Amtes, bei der „Attribuierung“, die zur Sanktionierung führte, gehe es „um die Aktivitäten von ‚red.‘, nicht um Nachfolgefragen“. Zur Finanzierung macht „red.“ keine näheren Angaben. Das Medium erhalte „Spenden von Organisationen und Einzelpersonen“. Der Vorwurf, „red.“ sei eine „Fortsetzung des Projekts redfish oder ein russisches Desinformationsmedium“ sei „unbelegt“ und „gezielt konstruiert“.
„Zwietracht säen“
Bleibt noch der Vorwurf, „red.“ verbreite „systematisch falsche Informationen über politisch kontroverse Themen“ und säe „Zwietracht“ in der Bevölkerung „durch die Verbreitung der Narrative über radikalislamische terroristische Gruppierungen wie die Hamas“. Die „taz“ empörte sich schon 2024 in ihrem Bericht über „red.“ als „RT-nahes Medium“. Die Plattform biete „islamistischen Terrororganisationen regelmäßig eine Bühne“. Im Fokus stand unter anderem eine Video-Reihe, die „red.“ ein Jahr nach dem Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten veröffentlichte.
Die Videos sind nach wie vor auf der Seite abrufbar. Unter einem mit pathetischer Musik unterlegten Trailer heißt es, am 7. Oktober hätten „Widerstandsgruppen den kolonialen Siedlerstaat Israel angegriffen“. Man habe zum Jahrestag mit der „Achse des Widerstands – Hamas, Islamic Jihad, PFLP, Hezbollah und Ansarallah – gesprochen“. Wer sich die verfügbaren Videos ansieht, bekommt distanzlose Interviews präsentiert, in denen nicht eine kritische Frage gestellt wird, die den jeweiligen Gesprächspartner auch nur annähernd herausfordern würde. Kein Wort darüber, dass die Hamas bei ihrem Massaker viele linke Israelis und Pazifisten ermordet hat. Kein Wort darüber, wie die israelische Linke auch nach dem 7. Oktober – unter einer ultrarechten Regierung im erbarmungslosen Rachemodus und inmitten einer feindseligen Gesellschaft – trotz allem um eine Friedensperspektive ringt. Kein Wort über ausgleichende Stimmen, die sich weder mit den Gewaltorgien der Hamas noch denen Israels gemein machen wollen. Stattdessen heißen alle Gesprächspartner das Massaker gut.
Dass ein „linkes“ Medium wie „red.“, das von sich behauptet, „jede Form militärischer Aggression“ abzulehnen, für eine solche Berichterstattung hart kritisiert wird, ist nachvollziehbar. Zugleich ist es keine Neuigkeit, dass der politische Streit und die mediale Auseinandersetzung zum Israel-Palästina-Konflikt mitunter heftig ausfallen. Wäre „red.s“ Berichterstattung nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, anderweitig presserechtlich problematisch oder gar strafrechtlich relevant, müssten mögliche Anschuldigungen in einem rechtsstaatlichen Verfahren geklärt werden. Solange niemand verurteilt ist, gilt die Unschuldsvermutung.
Zur Verdeutlichung sei an den Fall des Autors Maxim Biller erinnert. Wohl säte seine Ende Juni veröffentlichte ZEIT-Kolumne, in der er über die „strategisch richtige, aber unmenschliche Hungerblockade von Gaza“ sinnierte, „Zwietracht“ in der Bevölkerung. Und auch der „Witz“ am Ende der Kolumne, in dem ein Arzt einem israelischen Soldaten rät, nicht aufzuhören, „auf Araber zu schießen“, kann dazu beitragen „den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland“ zu „schwächen“. Die Kolumne wurde nach Protesten gelöscht. Aber wäre jemals ein EU-Bürokrat oder ein Vertreter der Bundesregierung auf die Idee gekommen, Biller oder die ZEIT-Redaktion wegen „destabilisierenden Aktivitäten“ auf eine Sanktionsliste zu setzen?
„Kritische Berichterstattung kriminalisieren“
Es scheint kaum möglich, bei „politisch kontroversen Themen“ „richtige Informationen“ von „falschen“ abzugrenzen, ohne autoritäre Sprachregelungen oder lizenzierte Wahrheiten zu verordnen und all jene zu verfolgen, die sich nicht daran halten. Die „Nachdenkseiten“ weisen darauf hin, dass mit der Argumentation, die Berichterstattung über „nicht genehme Proteste“ würde „indirekt Handlungen der Regierung der Russischen Föderation“ unterstützen, „sich ab jetzt bei Bedarf jede Art von kritischer Berichterstattung sanktionieren und kriminalisieren“ ließe.
Auch der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis warnt: „Morgen können sie genau dasselbe tun, wenn es um irgendein Thema geht, von dem sie nicht wollen, dass man darüber spricht.“ Dogru nimmt das Vorgehen gegen ihn als Test wahr. Die Repression könne sich in Zukunft auch gegen Journalisten richten, die über „Massenstreiks, Klimaaufstände oder Anti-Austeritäts-Proteste“ berichten.
Die Frage ist also: Wie wird angebliche „Desinformation“ von regierungskritischen, unbequemen Positionen oder verstörenden, aber von der Meinungsfreiheit gedeckten Ansichten unterschieden? Sowohl die Bundesregierung als auch die Europäische Kommission ließen entsprechende Nachfragen unbeantwortet.
Der Menschenrechtskommissar des Europarates Michael O’Flaherty hatte zwar erst im Juni in einem Brief an Innenminister Alexander Dobrindt die Einschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in Deutschland im Kontext des Gazakonflikt kritisiert – auf eine Anfrage zum Fall Dogru antwortete er jedoch nicht. Auch angefragte Vertreter von „Reporter ohne Grenzen“ und dem „Deutschen Journalistenverband“ äußerten sich nicht. Ebenso zeigten sich die Kollegen auf der Bundespressekonferenz Anfang Juli weitgehend gleichgültig. Alle im Bundestag vertretenen Oppositionsparteien sowie die FDP reagierten nicht auf entsprechende Anfragen.
„Ein Schritt in Richtung Totalitarismus“
Nur Sevim Dagdelen (BSW) antwortete. „Die Vorgehensweise von Bundesregierung und EU tritt die Pressefreiheit mit Füßen“, schreibt sie. Journalismus dürfe „kein Verbrechen sein“. Sie wertet das Ansinnen, bei kontroversen Themen falsche von richtigen Informationen zu trennen, als „Versuch einer regierungsamtlichen Wahrheitsproduktion“. „Zwietracht“ als Kriterium einführen zu wollen, sei „ein Schritt in Richtung Totalitarismus“. Es gehe offenbar darum, „Regierungshandeln von Kritik abzuschirmen – mit den Mitteln der Zensur und des Verbots“. Das Vorgehen erinnere sie „stark an den Versuch, jegliche Kritik an den Corona-Maßnahmen zum Schweigen zu bringen“. Die Bundesregierung und die EU-Kommission würden sich „offenbar vom Journalismus gestört“ fühlen und in „offener Zensur“ versuchen. Das sei eine „neue Qualität“.
Der Rechtswissenschaftler Volker Boehme-Neßler nannte bereits die Sanktionierung der Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper – bei deren Berichterstattung es immerhin einen inhaltlichen Bezug zum Krieg in der Ukraine gibt – „völlig unverhältnismäßig“. Normalerweise würden solche Sanktionen gegen Oligarchen, internationale Waffenhändler oder hochrangige Menschenrechtsverletzer verhängt – nicht gegen einzelne Journalisten. Die Sanktionierung sei nicht nur rechtswidrig, sondern auch „in hohem Maß einschüchternd“. Die in der EU geltende Pressefreiheit schütze auch Meinungen, die der herrschenden Meinung in Europa widersprechen.
Die Sprecherin der EU-Kommission für Außen- und Sicherheitspolitik, Anitta Hipper, erklärte auf Anfrage, die Entscheidungen des Rates „beruhen auf Rechtsstaatlichkeit“. Sobald eine Person gelistet werde, würde sie von der EU informiert. Das widerspricht Dogrus eigener Darstellung. Hipper betont, die betroffene Person habe das Recht, beim Rat Einspruch zu erheben und eine Streichung zu beantragen. Zudem habe jede gelistete Person das Recht, Rechtsmittel einzulegen und die Aufnahme in die Sanktionsliste vor europäischen Gerichten anzufechten. Der Inhalt dieser gerichtlichen Auseinandersetzungen sei jedoch „vertraulich“. Die EU-Gerichte seien unabhängig und würden sicherstellen, dass jegliche Listung „rechtmäßig“ sei. Jede Entscheidung, die Sanktionen „zu verlängern, zu ändern oder aufzuheben“ müsse vom Rat einstimmig getroffen werden. Der Rat könne eine Aufhebung der Sanktionen in Erwägung ziehen, falls er der Ansicht sei, dass das Ziel ihrer Verhängung erreicht sei.
Doch die „Rechtsstaatlichkeit“, auf die die EU hier abhebt, macht einen verdrehten Eindruck. Durch die Sanktionierung der EU werden praktisch Grundrechte entzogen, ohne dass ein Richter vorab Vorwürfe und Beweise prüft und ein Urteil spricht. Dass man das Recht hat, nachträglich vor Gericht – langwierig und kostspielig – für die Wiedererlangung seiner Rechte zu kämpfen, dürften Betroffene allenfalls als Hohn empfinden. Dogru selbst fasst es auf X so zusammen:
„Ich wurde nicht angeklagt. Ich stand nicht vor Gericht. Ich wurde keiner Straftat für schuldig befunden. Ich hatte keine Möglichkeit, mich zu verteidigen“.
Sevim Dagdelen spricht von einer „außergerichtlichen inneren Verbannung“. Was man in Deutschland rechtsstaatlich nicht durchbekomme, werde „über die Freunde in Brüssel geregelt“. Der Fall Dogru markiert vor diesem Hintergrund einen gefährlichen Kipppunkt: An die Stelle des harten politischen Disputs und transparenter, öffentlich nachvollziehbarer rechtsstaatlicher Verfahren treten politische Repression und eine mediale Auseinandersetzung, die mit Unterstellungen, Verdächtigungen und Vorverurteilungen arbeiten – und die direkt auf eine berufliche, soziale und wirtschaftliche Existenzvernichtung zielen.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 105.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 105.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: