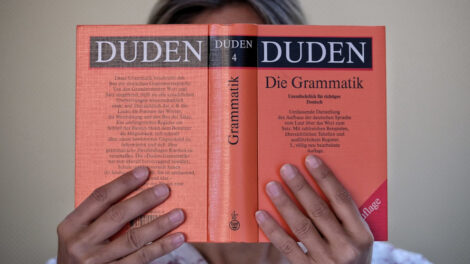Durch die Hintergründe und Absurditäten der Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin blickt keiner mehr so recht durch – und Afrikaner, die die Hauptstadt besuchen, schon gar nicht.
von Ulli Kulke
Nach langen Diskussionen in den Berliner Medien und Chatrooms sowie Streitigkeiten vor Gericht ist es nun vollbracht: Die Mohrenstraße im Berliner Bezirk Mitte wurde am Samstag, 23.8., umbenannt, in Anton-Wilhelm-Amo-Straße, auf Geheiß des Bezirksparlaments. Der Grund: Der Begriff „Mohr“ sei bei der Namensgebung (etwa 1720) rassistisch herabwürdigend gemeint gewesen. Einen Beleg dafür konnten die Betreiber der Umbenennung nicht beibringen. Doch die Gelegenheit war günstig, mal wieder durch veränderte Sprachregelungen die Welt zu retten.
Die Zeitgeschichte deutet eher auf die gegenteilige Lesart: Die Berliner war nämlich nicht die erste Mohrenstraße, die Gegenstand einer Umbenennung wurde. 1934 zum Beispiel, als die Nationalsozialisten in Coburg eine würdige Straße suchten, um sie in „Straße der SA“ umzutaufen, verfielen sie auf die dortige Mohrenstraße, prominent gelegen, aus dem Herzen der Stadt zum Bahnhof führend. Sie verlor also ihren alten Namen, und zwar aus „rassischen“ Gründen, wie das „Digitale Stadtgedächtnis“ des fränkischen Ortes schreibt. So viel Ehre sollte Afrikanern nicht mehr zugebilligt werden. Man darf also festhalten: In der Tilgung des Namens Mohrenstraße hat jenes Berliner Bezirksparlament mit seiner rotgrünen Koalition („Zählgemeinschaft“) ein würdiges Vorbild von vor 91 Jahren.
Spaß beiseite: Eines zeigt der Beschluss von 1934: Die Benennung einer Straße nach „Mohren“ wurde von Anfang an keinesfalls als Herabwürdigung angesehen, ganz im Gegenteil. In Coburg ziert ein offensichtlicher Afrikaner sogar das Stadtwappen, der „Coburger Mohr“, der den heiligen Mauritius darstellt. In Berlin wurde die Straße wohl um 1720 angelegt und nach dort lebenden schwarzen Afrikanern benannt, die im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert nach Berlin gekommen waren. Unter den von Historikern diskutierten verschiedenen Varianten von Herkunft und Tätigkeiten jener Afrikaner in Berlin gibt es keine einzige, die Anlass dafür böte, dass der Straßenname – und damit auch der Begriff „Mohr“ – despektierlich gemeint gewesen sein könnte.
Eine solche Vorstellung wäre in jedem Fall widersinnig. Ausgerechnet inmitten eines Stadtviertels, in dem die Namen von Angehörigen der Hohenzollern wie Friedrich, Wilhelm, Georg, Dorothee, und wie sie alle hießen, die Straßen zierten, um sie zu ehren, sollte eine andere nach einer Gruppe von Anwohnern benannt werden, nur um diese herabzuwürdigen? Ein absurder Gedanke, den ich hier an dieser Stelle bereits einmal also solchen dargestellt habe.
Kapitel der Afrikaner in Berlin erfolgreich aus dem Stadtbild getilgt
Die Afrikaner, die damals in Berlin lebten, gehören zur Geschichte Berlins. Dieses Kapitel wurde nun auf Betreiben der Grünen, der Linken und der SPD mit ihrer Mehrheit im Bezirk Mitte aus dem öffentlichen Stadtbild erfolgreich getilgt. Jener Anton-Wilhelm Amo, nach dem die Straße jetzt heißt, kann hierfür keinen Ersatz darstellen. Er war ein hochinteressanter Mann, aber er war nie in Berlin. Interessant ist nicht zuletzt, dass Amo – ein angesehener Philosoph und Rechtsgelehrter – eine Schrift verfasst hat mit dem Titel: „Disputation über die Rechtsstellung des Mohren in Europa“. „…des Mohren“? War der Schwarze also ein Rassist? Nach Logik der Betreiber der Umbenennung muss man wohl davon ausgehen.
Auch die Behauptung der Betreiber, die Umbenennung der Straße solle nun den wohl aus Ghana stammenden Mann, der zu Beginn des 18. Jahrhundert als afrikanischer Gelehrter in Deutschland lebte, endlich mal zu verdienter Bekanntheit führen, ist eher irreführend. Amo war einschlägig wohlbekannt. Es gibt bereits unzählige wissenschaftliche Abhandlungen, Essays, Bücher – darunter Romane – über ihn, hier ist eine Auswahl davon aufgelistet.
Eine der letzten größeren Arbeiten über Amo stammt aus der Feder des Historikers Professor Thomas Sandkühler. Seine ausführliche, aber dennoch sehr lesbare Auseinandersetzung mit der Biografie Amos, aber auch mit erheblichen Schieflagen in der Argumentation der Umbenennungs-Betreiber, erschien in der Ausgabe Januar 2025 der „Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins“ und ist als pdf im Netz zu lesen (Seiten 15 bis 36). Sandkühler zeigt die privilegierte Stellung Amos, der 1707 als Kind mit einem Sklavenschiff – aber nicht als Sklave – nach Amsterdam zu seiner dorthin vorausgereisten Mutter gebracht wurde, und schließlich als Gelehrter in Wolfenbüttel und an den Universitäten in Wittenberg, Halle und Jena unterrichtete, bevor er 1746 nach Ghana zurückkehrte. Sandkühler geht der Frage nach, ob Amo aus einer Familie stammt, deren Reichtum womöglich auch aus dem Verkauf beziehungsweise der Vermittlung von Sklaven für den europäischen und amerikanischen Markt stammen könnte. Er kann einige deutliche Hinweise für diese Lesart anführen.
Beteiligung am Festakt am Samstag eher verhalten
Die Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße ging in Berlin nicht ohne Kontroversen über die Bühne. Noch sind Gerichtsverfahren anhängig, in denen Anwohner gegen die Maßnahme klagen. Eilverfahren, deren Betreiber aus diesem Grund den Akt der Umbenennung noch herausschieben wollten, ergaben in letzter Sekunde: Die Straßenschilder durften ausgewechselt werden. Angesichts des Wirbels, den die Angelegenheit in den letzten Tagen und Wochen ausgelöst hat, war die Beteiligung am Festakt am Samstag eher verhalten mit einigen wenigen hundert Teilnehmern am Hausvogteiplatz. Dass in Berlin oder in der Anwohnerschaft eine Mehrheit für die Umbenennung ist, darf eher bezweifelt werden.
Es hat bis zuletzt keine belastbaren Hinweise darauf gegeben, dass der Begriff „Mohr“ oder „Mohrenstraße“ allgemein herabwürdigend gemeint gewesen sein könnte. Eine mehrseitige Stellungnahme des Instituts für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität will dies zwar behaupten, kann allerdings an Beispielen auch lediglich einzelne zeitgenössische Aussagen beibringen, deren Urheber sich despektierlich über „Mohren“ äußern, ohne dass sich daraus eine allgemeine herabwürdigende Konnotation des Begriffs selbst ergäbe. Da dies immer offensichtlicher wurde, brachte man ersatzweise vor, dass Schwarze sich heute von dem Begriff verunglimpft fühlten. Doch aus einem Wort, das seit langem komplett aus dem deutschen Sprachgebrauch verschwunden ist, das auch deshalb aus keiner geläufigen Schimpf-Kombination bekannt ist (völlig anders als beim „N“-Wort), konnte auch im aktuellen Zusammenhang kaum Überzeugungskraft für den Rassismus-Vorwurf generiert werden.
In den Blättern der Hauptstadt, den sozialen Medien, den überlaufenden Foren für Leserkommentare etwa beim Berliner Tagesspiegel wurde letztlich immer deutlicher, dass der Streit sich um die Deutungshoheit für Begrifflichkeiten aus dem ethnischen, kolonialhistorischen Zusammenhang drehte. Die Betreiber der Umbenennung warfen den Gegnern vor, sie seien diesbezüglich aus reinen Verlustängsten getrieben. Während in Gegenrichtung der Vorhalt von Cancel Culture, Sprachverboten und Ähnlichem genannt wurde. Das Bestreben, das Wort „Mohr“ auf den Index zu setzen, ist (auch wenn es heute niemand mehr benutzt) immerhin in einer Reihe zu verorten, in der oftmals gestern noch anerkannt war, was heute schon verpönt ist und man schnell den Überblick verlieren kann.
„Schwarzer“ nur noch als Selbstbezeichnung zu akzeptieren
Nach dem vor Jahrzehnten bereits – weitgehend akzeptierten – Verzicht auf das N-Wort ging es schließlich zügig weiter. Das zunächst kurzzeitig dafür anempfohlene Wort „Farbiger“ war seinerseits wenig später schon verpönt. Wohingegen das wörtlich übersetzte „People of Color“ (PoC) im englischsprachigen Raum derzeit als allseits anerkannte Sprachregelung gilt. Im Deutschen war „Schwarzer“ lange Zeit als genehm verkündet. Inzwischen allerdings mehren sich die Stimmen, „Schwarzer“ nur noch als Selbstbezeichnung zu akzeptieren, nicht aber aus weißem Mund. Vor allem soll Schwarz immer mit großem S, weiß aber immer mit kleinem w geschrieben werden, beides obendrein kursiv, auch als Zeichen dafür, dass es sowieso auf keinen Fall um die Hautfarbe geht, sondern um ein „soziales Konstrukt“. Die Regelkunde lässt eines klar erkennen: Es geht um Deutungshoheit, keine Frage.
Die Schwarze Community ist sich bei diesen Fragen nicht einig, weder im Detail noch in der Rigidität. Dies gilt auch beim Streit um die Mohrenstraße, bei dem einzelne Vertreter der schwarzen Community, die die Sache ins Rollen gebracht hatten, in dieser Frage schnell Unterstützung im linksgrünen Lager erhielten. Dies nicht zuletzt auch, weil man dort mal wieder eine Chance sah, im eigenen Spektrum gegen das Mitterechts-Lager zu punkten.
Auf den Fotos von der feierlichen Umtaufe am Hausvogteiplatz jedenfalls sind deutlich mehr weiße als Schwarze zu sehen. Dies könnte damit zusammenhängen, was der Historiker Ulrich von der Heyden, der sich mit Straßenumbenennungen, insbesondere mit der Mohrenstraße, im Deutschlandfunk feststellte:
„Ich bin seit über 30 Jahren in der Afrikawissenschaft unterwegs, bekomme viele Besuche aus Afrika, zeige den Afrikanern auch die Stadtmitte von Berlin. Wir sind in der Mohrenstraße, wir diskutieren darüber – keiner von denen hat sich bisher in irgendeiner Weise da negativ konnotiert gefühlt. Die Afrikaner verstehen nicht, was hier in Berlin oder überhaupt in Deutschland vor sich geht, wenn man um dieses Wort ‚Mohr‘, um diese Bezeichnung streitet.“
Man darf erst recht annehmen, dass jene „Mohren“, nach denen die Straße damals benannt wurde, ebenfalls kein Verständnis dafür hätten, dass sie als Namensgeber „entsorgt“ würden.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 108.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 108.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: