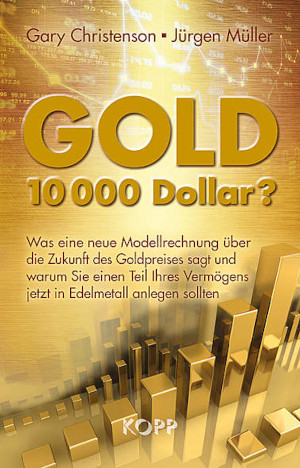Auch das Geld- und Währungssystem gerät in den Strudel von politischen Machenschaften. Die Furcht vor dem digitalen Euro, Inflation und Krisenangst treiben den Goldpreis und die Suche nach alternativen Geldformen.
Die Krise um Geld und Erspartes ist im Mainstream angekommen: Bild am Sonntag warnt „vor dem nächsten Crash“ mit der Schlagzeile: „So schützen Sie Ihr Geld“ und heizt den Wettlauf um Gold weiter an: „Gold ist die ultimative Krisen-Anlage“. Das allerdings genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Goldpreis wieder unter die magische Grenze von 4.000 Dollar je Feinunze rutschte. Aber immerhin, nach einem kurzen Rücksetzer vom Rekordhoch werden neue Höchstwerte erwartet.
Jamie Dimon, Vorstandschef der US-Großbank JP Morgan Chase, gehörte nach eigenen Angaben bisher privat nicht zu den Goldinvestoren. „Ich bin kein Goldkäufer – es kostet vier Prozent, es zu besitzen“, meinte Dimon kürzlich auf der „Fortune’s Most Powerful Women Conference“ in Washington. Umso erstaunlicher fiel seine Prognose zur weiteren Preisentwicklung des Edelmetalls aus: „Aber es könnte in einem Umfeld wie diesem leicht auf 5000 oder 10000 Dollar (pro Unze) steigen. Das ist eine der wenigen Zeiten in meinem Leben, in der es halbwegs rational ist, etwas Gold im Portfolio zu halten.“
Gold statt Dollar
Wenige Tage vor Dimons Auftritt erklärte Ken Griffin, Gründer des Hedgefonds Citadel, Investoren würden zunehmend Gold dem durch Rekordschulden belasteten Dollar vorziehen – was Griffin als „wirklich besorgniserregend“ nannte. Fast zeitgleich machte Ray Dalio, Gründer der Investmentgesellschaft Bridgewater Associates, seine Ansichten zur Papierwährung und zum Gold deutlich: „Die schlechte Schuldensituation des Dollars und anderer Reservewährungen bedroht deren Attraktivität.“ Dalio rät deshalb dazu, mindestens 15 Prozent des Ersparten entweder in Edelmetallen oder Bitcoin zu parken. Griffin und Dalio gelten ausweislich der Erfolgsgeschichte ihrer Fonds als Schwergewichte, wenn es um Markteinschätzungen geht.
Den Banker Dimon, der seit 2005 an der Spitze von JP Morgan steht, betrachten die Kollegen als Primus der Branche: Sein Institut erwirtschaftete 2024 einen Jahresüberschuss von 56,86 Milliarden Dollar – mehr als der Umsatz der Deutschen Bank.
Die drei Finanzexperten betonten den Hauptgrund für den langfristigen Anstieg des Goldpreises in den kommenden Jahren: der Vertrauensschwund in die Fiat-Währung angesichts weltweit extrem steil ansteigender Schulden. Laut Internationalem Währungsfonds erreicht die Gesamtverschuldung aller Volkswirtschaften der Welt 2025 die gigantische Summe von 100 Billionen Dollar. Davon entfallen mehr als ein Drittel, nämlich 37,2 Billionen, auf ein einziges Land: die USA. Ökonomen sprechen in solchen Fällen von einem Klumpenrisiko. Das Land verzeichnet derzeit eine Schuldenquote von 123 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ohne eine grundlegende Änderung der US-Haushaltspolitik steigt diese Kennzahl bis 2030 auf 143 Prozent.
In der Eurozone sieht es nicht wesentlich besser aus: In Frankreich, derzeit mit 115 Prozent seiner Wirtschaftsleistung verschuldet, beendete die von linken Stimmen abhängige Wackel-Regierung alle bisher ohnehin nur zaghaften Versuche zur Haushaltskonsolidierung. Italien (137 Prozent) und Griechenland (159 Prozent) übertreffen schon heute das US-Verhältnis zwischen Wirtschaftskraft und Außenständen. Und auch im bisher vergleichsweise soliden Deutschland klettert die Staatsschuldenquote bis 2029 auf 80 Prozent.
Gold statt Aktien?
Dazu kommt: Die stärkste Volkswirtschaft der EU steckt in einer hartnäckigen Rezession ohne Aussicht auf ein Ende. Seit 2019 wuchs die deutsche Wirtschaftsleistung gerade um ein halbes Prozent – während die US-amerikanische im gleichen Zeitraum um 12,5 Prozent zulegte. Neben dem Misstrauen gegen unsolide Staatsfinanzen und deren Papierwährungen trieben auch Goldkäufe der Zentralbanken seit 2024 den Kurs der Barren und Münzen. Als drittes Motiv kommt der derzeit überhitzte amerikanische Aktienmarkt dazu: Sehr viele Anleger rechnen derzeit nicht mit einer ungebrochenen Aufwärtsbewegung, sondern im Gegenteil mit einem heftigen Rückschlag. Da Staatspapiere aktuell auch wenig abwerfen, stellt sich sowohl kurz- als auch langfristig die Frage nach anderen Anlagen. Seit Jahresbeginn 2025 legte das Wertspeicher-Metall Nummer eins in Euro 38,1 Prozent, in Dollar sogar 52,29 Prozent zu – trotz des Preisrücksetzers im Oktober, als der Wert pro Unze nach dem Rekord von über 4300 Dollar wieder unter die 4000-Dollar-Marke fiel.
Auch dafür gibt es wiederum mehrere Gründe: erstens hier und da Gewinnmitnahmen nach dem rasanten Anstieg des Goldpreises, zweitens eine gewisse Beruhigung der Märkte, da sich der Handelsstreit zwischen den USA und China vorerst etwas entspannt. Außerdem treiben die Zölle die Verbraucherpreise in den USA weniger stark als von vielen Ökonomen angenommen. Die US-Inflation bleibt also moderat. An allen langfristigen Gründen für die Goldaufwertung – Staatsverschuldung, Misstrauen gegen das Papiergeld, Goldkäufe der Zentralbanken – ändert sich allerdings nichts. Die Faktoren bleiben auf lange Sicht mächtig. Deshalb machte der Goldpreis knapp unter der 4000-Dollar-Marke Halt. Für alle, die wie die meisten Marktbeobachter mit mindestens 5000 Dollar je Unze bis spätestens 2028 rechnen, ergibt sich gerade eine attraktive und vermutlich nur kurze Einstiegsmöglichkeit.
Verfassungsschutz warnt vor Goldbesitzern
Nach Alternativen zum Fiat-Geld – bar oder auf dem Konto – sollte sich sowieso jeder Sparer umsehen. Denn der durchschnittliche Zinssatz auf Sicht-, Fest- und Spareinlagen liegt derzeit in Deutschland bei gerade 0,75 Prozent – also deutlich unter der Inflationsrate von 2,3 Prozent. Unter dem Strich ergibt sich daraus ein Realzins von minus 1,55 Prozent pro Jahr. Das klingt nicht viel. Aber auch im negativen Bereich wirkt die Dynamik von Zins und Zinseszins. Bliebe es die kommenden Jahre bei den jetzigen Werten, dann bedeutete das bis 2035 eine Vermögensschmelze von satten17 Prozent.
Vor wenigen Tagen kam noch ein zusätzliches Kaufargument für das Wertmetall hinzu – von einer Behörde, die sich normalerweise nicht um Finanzfragen der Bürger kümmert, nämlich dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Schon der Weg der Verfassungsschutz-Expertise zu Gold in die Öffentlichkeit gestaltete sich reichlich bizarr: Der „Tagesspiegel“ stellte dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla mehrere Fragen zu dem Gold, das die Partei besitzt. Dabei berief sich das Blatt gegenüber dem Politiker auch auf eine Einschätzung, die der Geheimdienst wohl eigens für die Zeitung erstellt hatte.
Darin heißt es in konfuser Diktion und völlig belegfrei: „Edelmetalle sind somit nicht nur Teil einer rechtsextremistischen Finanzierungsstrategie, sondern das Bewerben dieser trägt vor dem Hintergrund der durch die Akteure konstruierten Bedrohungsszenarien indirekt auch zur Verbreitung von antisemitischrechtsextremistischen Vorstellungen und Narrativen bei.“ Chrupalla fragte den „Tagesspiegel“, warum er diese Einschätzung des Verfassungsschutzes seinen Lesern bisher nicht präsentierte.
Bei dem Textbaustein handelt es sich einerseits um eine Groteske – denn niemand muss „Bedrohungsszenarien“ für das Ersparte erst konstruieren. Was die Werbung für den Kauf von Edelmetallen mit Antisemitismus zu tun haben sollte, bleibt das Geheimnis des Dienstes. Viele, die davon erfuhren, argwöhnen, dass der Staat auf diese Weise Gründe schaffen will, um den Goldhandel erstens noch stärker als bisher zu überwachen, und zweitens den steuerfreien Verkauf von Gold nach einem Jahr Haltefrist abzuschaffen. Möglicherweise gibt es diese Pläne tatsächlich.
Aber die beleglose Verknüpfung von Goldhandel, Gold als Vermögenssicherung und Rechtsextremismus beziehungsweise Antisemitismus kursiert schon länger. Die Behauptung stellten die Autoren Liane Bednarz und Christoph Giesa bereits 2015 in ihrem Buch Gefährliche Bürger auf, in dem es raunend heißt, „Crash-Apologeten“ hätten ein Interesse daran, dass das „anlagefreudige Publikum immer eine Art Grundpanik verspürt“. So, als müsste ein Goldhändler den Leuten die Geldentwertungsangst erst mühsam einreden. Im August 2021 titelte die ZEIT: „Goldgräber am rechten Rand“ zusammen mit der Unterzeile: „Erst bringen sie Verschwörungstheorien unters Volk – dann Goldbarren: Ein Netzwerk von Edelmetallhändlern und Influencern verdient Geld mit rechter Hetze.“
Das Blatt zitierte damals einen Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, mit der Behauptung: „Im rechtsradikalen Milieu erwartet man ja auch den nahenden Untergang des politischen Systems. Das ist genau die Erwartungshaltung, bei der Gold als einzig sicherer Hafen gilt. Aber Gold und Silber sind nicht krisensicher. Von solchen Geschäften profitieren einzig die Händler.“ Seit 2021 hat sich der Goldpreis mehr als verdoppelt. Wer also dem Rat für Anleger folgte und kaufte, um etwa 10 bis 15 Prozent des Ersparten in das Metall zu stecken, der profitierte sehr wohl – anders als alle, die nur auf die Geldwertstabilität vertrauten.
Dass eine staatliche Institution absurde Verdächtigungen gegen Goldanbieter und -käufer verbreitet, kam bisher noch nicht vor. Der Verfassungsschutz-Vorstoß im Zusammenspiel mit einer regierungsfreundlichen Zeitung fällt in eine Phase, da die EZB mit der Einführung des digitalen Euro beginnt, der Transaktionen grundsätzlich kontrollierbar macht. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem „Vermögensregister“, mit dem der Staat erstmal zumindest Zugriff auf die Information des privat Ersparten erhalten würde. Drittens soll neben der Bargeldobergrenze von 10.000 Euro pro Transaktion bis 2027 EU-weit auch die Regel eingeführt werden, dass schon Bar-Transaktionen ab 3000 Euro einer Registrierung der Personaldaten bedürfen. Damit würde die wichtigste Eigenschaft des Bargelds angetastet – seine Anonymität. Bei barem Goldkauf und -verkauf gilt in Deutschland schon seit einiger Zeit die Obergrenze von 1999 Euro.
Lasst uns unser Bargeld
Die Atlas-Initiative startet gerade die Aktion „Lasst uns unser Bargeld – und lasst uns unsere Wahlfreiheit“, für die es gute Gründe gibt. Bargeld bedeute Privatsphäre. Der zur Einführung anstehende digitale Euro soll gestoppt werden, weil er die totale Überwachung jeder Zahlung ermöglicht und die Konten und Geldbestände per Knopfdruck blockiert werden können. Vor allen Dingen soll ein Währungswettbwerb eröffnet werden: Das bedeutet, dass die Bürger entscheiden, mit welchem Geld sie bezahlen – ob mit Bargeld, Euro, Gold, Bitcoin oder anderen stabilen Alternativen. Nur so könne die Vielfalt im Geldwesen geschützt und Machtmissbrauch wie Überwachung verhindert werden. Auf mindestens 50.000 Unterschriften für eine entsprechende Petition hoffen die Initiatoren.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: