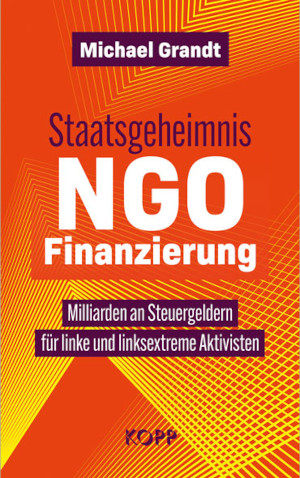Der Hamburger Klimaentscheid stürzt die Stadt ins Chaos. Dahinter steht eine Mobilisierungskampagne mit massivem Rückenwind aus den Staatskassen – die gerade bei einer gefährlich niedrigen Wahlbeteiligung ins Gewicht fällt.
von Marie Rahenbrock
„Das ist ein Gewinn für uns alle in Hamburg und ein gewaltiger Erfolg, für den wir gemeinsam lange und hart gekämpft haben“, jubelten die Befürworter des Hamburger Zukunftsentscheids, als am 12. Oktober klar wurde, dass die Hansestadt bereits 2040 klimaneutral werden soll – fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Jetzt ist sie dazu gesetzlich verpflichtet. 303.936 Menschen haben mit ihren Ja-Stimmen allen 1,8 Millionen Einwohnern eine Last aufgebürdet, deren wirtschaftliche Folgen verheerend sein werden, deren volles Ausmaß aber noch nicht gänzlich abzuschätzen ist.
Hamburgs Zukunft soll sich drastisch ändern, das ist sicher: steigende Mieten, höhere Energiekosten, höhere Lebensmittelpreise, Firmen, die pleitegehen oder abwandern, massenhafte Arbeitslosigkeit. Wer hat diese Entscheidung getroffen? Die Wahlbeteiligung lag an jenem Sonntag bei 43 Prozent. Von diesen stimmten 53 Prozent für den Zukunftsentscheid. Die Wahlbeteiligung von 43 Prozent ist äußerst wenig angesichts dessen, dass über die langfristige Zukunft des Stadtstaates entschieden wurde. Zum Vergleich: Bei der Bürgerschaftswahl im März lag die Wahlbeteiligung bei 67,7 Prozent.
Das Abstimmungsergebnis ist weniger Ausdruck des Willens der Wähler als vielmehr der Frage, wer am meisten Menschen zur Abstimmung mobilisieren konnte. Daher lohnt es sich, genauer zu betrachten, wie diese Mobilisierung verlief – und welche wichtige Rolle dabei staatlich geförderte Organisationen spielten.
Über 60 Bündnisse, Vereine und Umwelt-NGOs haben vor der Abstimmung öffentlich ihre Unterstützung für den Hamburger Zukunftsentscheid bekundet. Rund ein Drittel dieser Organisationen erhalten Geld vom Staat. Mit dem Deutschen Schauspielhaus war sogar eine staatliche Institution direkt an der Mobilisierungskampagne beteiligt. Die Hamburger Kunsthallen werden staatlich gefördert.
Zu den Organisationen, die den Entscheid unterstützt haben, zählen die Studentenvertretung der Hamburger Universität (AStA), kirchliche Organisationen, zahlreiche Umweltvereine und auch Gewerkschaften. Während viele kleinere Hamburger Lokalvereine wie der Hamburger Energietisch oder Greenpeace Hamburg rein spendenbasiert arbeiten, gibt es auch ein Netz von staatlich geförderten Verbänden. Manche der Unterstützerorganisationen haben zwar selbst kein Geld vom Staat bekommen, dafür aber Vereine, die wiederum bei ihnen Mitglied sind.
taatlich geförderte Lokalvereine
Ein wichtiger Unterstützer des Zukunftsentscheids war der Hamburger Zukunftsrat. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Nachhaltigkeitsstrategie für Hamburg zu formulieren und die Bürgerbeteiligung zu fördern. Der Verein wird von der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung gefördert sowie von der Hamburger Behörde für Umwelt und Klima. Aus den Einnahmen des Vereins, die auf seiner Webseite veröffentlicht sind, geht hervor, dass staatliche Förderungen in den letzten Jahren über 70 Prozent seiner Einnahmen betragen.
2024 machten die staatlichen Förderungen der Hamburger Umweltbehörde 72 Prozent der Einnahmen des Hamburger Zukunftsrat aus: Von insgesamt 67.790 Euro an Einnahmen kamen 49.000 Euro von der Regierung der Hansestadt. 2023 betrug die Quote der staatlichen Finanzierung an den Gesamteinnahmen sogar 74,8 Prozent. Von 58.803 Euro an Einnahmen stammten 44.000 Euro von staatlicher Förderung. 2022 stammten wieder 72 Prozent der Einnahmen von der Hamburger Umweltbehörde.
Auch der staatlich geförderte NABU Hamburg war an der Klimakampagne, die zum erfolgreichen Bürgerentscheid geführt hat, beteiligt. Er erhielt 2024 insgesamt 433.948 Euro an staatlichen Zuschüssen, wie aus seinem Geschäftsbericht hervorgeht. Das entspricht einem Anteil von 18,2 Prozent an den Gesamteinnahmen. Spenden brachten lediglich 411.525 Euro ein, was einem Anteil von 17,3 Prozent ausmachte. Den größten Posten stellten die Mitgliedsbeiträge mit 653.893 Euro dar. Die Summe der staatlichen Zuwendungen entspricht zwei Dritteln der Summe der Mitgliedsbeiträge. 2023 erhielt der NABU Hamburg rund 389.000 Euro an staatlichen Zuschüssen, was 15,4 Prozent der Einnahmen ausmachte. Der Verein warb auf Instagram und mit einem Stand in der Innenstadt dafür, dass Menschen beim Volksentscheid für den Gesetzesentwurf stimmen.
Weitere lokale Verbände, die sich für den Zukunftsentscheid stark machten, sind die Türkische Gemeinde Hamburg, der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein und der Verein Leben mit Behinderung Hamburg. Die Türkische Gemeinde wurde von 2015 bis 2019 im Rahmen des Projektes „Demokratie leben“ für ein Projekt gegen Antisemitismus gefördert, das auch muslimischen Antisemitismus ansprach; ein Integrationsprojekt wurde von der Hansestadt Hamburg gefördert. Der Kirchenkreis erhielt eine staatliche Förderung für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Das Projekt läuft bis September 2025. Ziel des Kirchenkreises ist es, bis 2035 klimaneutral zu werden. Gefördert wurde das Projekt vom Wirtschaftsministerium.
Der Verein „Leben mit Behinderung Hamburg“ bietet unter anderem betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung an, Beratungsangebote für Familienangehörige oder Freizeitangebote wie Theaterkurse. Zu dem Verein gehören mehrere Stiftungen und auch eine gemeinnützige GmbH. Die GmbH erhält von der Hamburger Behörde für Soziales für die Jahre 2024 bis 2028 insgesamt 299 Millionen Euro. Jährlich gibt es rund 60 Millionen Euro, wie aus einer Rahmenvereinbarung hervorgeht, welche die GmbH auf ihrer Webseite veröffentlichte.
Bundesweit tätige Vereine, die staatlich gefördert wurden
Neben lokalen Hamburger Vereinen haben auch bundesweit tätige Vereine den Volksentscheid unterstützt, die staatliche Förderungen bekommen haben. Zu nennen ist vor allem der „Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft“ (BNW). Dieser Verband wurde 1992 gegründet. Ihm gehören zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Bau, Drogerie, Lebensmittel, Gesundheit oder Einzelhandel an, darunter DM, Otto, die Naturstrom AG oder followfood. Wie aus dem Jahresbericht 2024 hervorgeht, stammt die Hälfte der Einnahmen aus verschiedenen staatlichen Förderungen. Von den insgesamt 2,2 Millionen Euro, die der Verein im vergangenen Jahr bekam, wurden lediglich 36 Prozent über Mitgliedsbeiträge und Spenden akquiriert.
Der BNW erhielt unter anderem Geld von den Umweltministerien in Baden-Württemberg und Sachsen sowie von der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft. Auch das Bundeswirtschaftsministerium förderte den Verein. So zahlte die Berliner Senatsverwaltung einmal 511.407 Euro, was 23 Prozent entspricht. Außerdem bekam der Verein von der Senatsverwaltung weitere 400.000 Euro, die an Projektpartner weitergeleitet werden sollten – das wurde auch getan. Vom Bundeswirtschaftsministerium gab es 66.705 Euro. 2023 betrug der Anteil der nicht-staatlichen Spenden sogar nur 28 Prozent an den gesamten jährlichen Einnahmen.
Auch die Deutsche Umwelthilfe erhielt 2024 Geld vom Umweltministerium und vom Bundesamt für Naturschutz. Die Organisation Green Legal Impact wurde vom Bundesumweltamt gefördert. Das Umweltbundesamt förderte auch einzelne Projekte der Organisation „German Zero“, wie zum Beispiel das Projekt „Kommunale Klimafinanzierung langfristig sichern – am Beispiel der Wärmewende“.
Dazu kommen indirekte Förderungen. So erhielten Organisationen wie der Landesfrauenrat Hamburg zwar keine direkte Förderung vom Staat, allerdings wurden Mitgliedsvereine finanziell gefördert. Beispielsweise wird die Frauenberatungsstelle „biff Eimsbüttel/Altona“ finanziell von der Hamburger Sozialbehörde gefördert, wie es auf deren Webseite heißt. Biff steht für „Beratung und Informationen für Frauen“.
Die Machtlosigkeit der regierenden SPD
Bei dieser Fülle an direkter oder indirekter staatlicher Unterstützung der Pro-Bürgerentscheids-Akteure in Hamburg drängt sich ein Verdacht auf: Hat die Regierung des Stadtstaats über Umwege ein politisches Ziel durchgesetzt, für das sie auf dem verfassungsgemäßen Weg über das Parlament keine Mehrheit gefunden hätte? Von der Wirkung her kommt der Bürgerentscheid einem Gesetzbeschluss der Hamburgischen Bürgerschaft, dem Landesparlament, gleich. Denn abgestimmt wurde beim Zukunftsentscheid nicht über allgemein gehaltene Ziele, sondern über einen konkreten Gesetzentwurf zur Änderung des Hamburger Klimaschutzgesetzes. Der nun erfolgreich durchgesetzte Entwurf schreibt vor, dass die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase bis 2040 um 98 Prozent reduziert werden soll. Durch natürliche CO2-Senken sollen zwei Prozent eingespart werden, sodass die Stadt „klimaneutral“ wäre.
Die Regelung sieht auch vor, dass von 2026 an bis 2040 jährliche CO2-Budgets festgelegt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Hamburg seine Klimaziele erreicht. Im kommenden Jahr dürfen demnach nur noch 9,6 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden, was einer Reduktion um 53 Prozent entspricht. 2030 sind es nur noch 6,146 Millionen Tonnen. Das entspricht einer Reduktion um 70 Prozent. 2040 dürfen nur noch 424.000 Tonnen ausgestoßen werden. Außerdem gibt es jährliche Sektorziele für Bereiche wie private Haushalte, Industrie und Verkehr.
Die Frage der staatlichen Finanzierung fällt besonders ins Gewicht, wenn, wie im Falle dieses Volksentscheids, die Frage der Wahlbeteiligung so zentral für das Ergebnis wird. Während ein Großteil der Bevölkerung einen gewöhnlichen Sonntag verbracht hat, konnte ein bestimmtes Milieu besonders mobilisieren – und diese Mobilisierung gelang mit massivem Rückenwind aus den Staatskassen. Während die einen abends eine kurze Nachricht gelesen haben, dass irgendein Volksentscheid angenommen wurde, haben die anderen dafür gesorgt, dass am Montag alle in einem anderen Hamburg aufwachen.
Der in Hamburg regierenden SPD scheint dieses ambitionierte Vorhaben selbst nicht ganz geheuer zu sein. Denn im Vorfeld der Abstimmung warnte deren Bürgerschaftsfraktion davor, dass 2040 als Ziel unrealistisch sei und dass die jährlichen CO2-Grenzen zu starr seien. Der Klimaentscheid werde „zu erheblichen Belastungen und Einschnitten in Hamburg bei Privathaushalten und Wirtschaft führen“. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher versäumte es jedoch, eine entschiedene Gegenkampagne zu führen. Er überließ den Befürwortern des strikten Klimaregimes das Feld. Und nach der Abstimmung bekräftigte Tschentscher im Rathaus, dass der Senat das Bürgervotum umsetzen werde. Es scheint, dass der Staat beginnt, den Einfluss auf die Ideologen zu verlieren, die er finanziert.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 104.500 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 104.500 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: