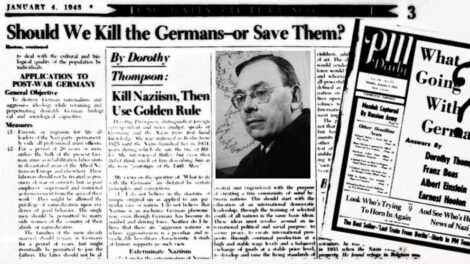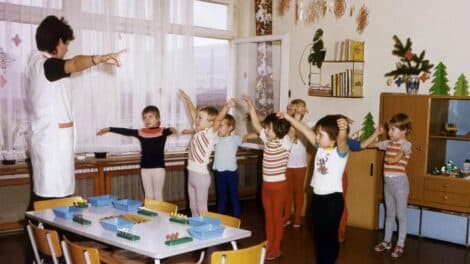Die Fußball-Nationalmannschaft der DDR lief der westdeutschen Konkurrenz von Beginn an hinterher. Dabei mangelte es nicht an Talenten. Doch die Politik packte zuverlässig ihre Bremsklötze aus.
Am Beginn stand eine Zitterpartie. In der 35. Minute durchbrach Bulgariens Stürmer Iwan Kolew am 14. Juni 1953 die deutsche Deckung. Doch der scharfe Schuss zog knapp am Pfosten vorbei. Wenig später balgte sich der bulgarische Sturm geradezu vor dem Kasten der Gastgeber, aber Torhüter Wolfgang Klank fischte das Leder aus der Luft. Erst der Schlusspfiff ließ die 55.000 Zuschauer im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion aufatmen. Mit einem torlosen Remis hatte die DDR-Nationalmannschaft ihr erstes Heimspiel wohl nicht bravourös, aber doch vorzeigbar über die Zeit gebracht. Für Klank wurde es dennoch der letzte Auftritt im Nationaldress. Einen Spielerboykott gegen die harten Trainingsmethoden seines Vereins Motor Dessau verziehen ihm die Verantwortlichen nie.
Der Fußball blieb in der DDR ein Stiefkind.
Was folgte, wurde nie erforscht. Das Neue Deutschland, als SED-Zentralorgan Leitmedium der DDR, überging die Partie mit Schweigen. Das Blatt vermeldete stattdessen die gleichzeitige 2:1-Niederlage der B-Auswahl in Sofia. «Die deutsche Mannschaft wurde von den zahlreichen Zuschauern stürmisch begrüßt und nach Spielschluss für ihre guten Leistungen gefeiert», notierten die Chronisten. War dies ein Akt journalistischer Renitenz? Immerhin galt in der B-Elf das Leistungsprinzip, während die A-Mannschaft vor allem nach politischen Kriterien zusammengesetzt war. Oder gerieten in den bereits kritischen Tagen kurz vor dem Aufstand am 17. Juni schlicht die Berichte durcheinander?

Wenn wohl auch unbeabsichtigt, so illustriert die Anekdote die Krux des DDR-Fußballs. Als populäre Massensportler waren die Kicker zwischen Ostsee und Erzgebirge unverzichtbar. Doch für politische Propaganda taugten die Mannschaften ebenso wenig wie für die später auf dem sportpolitischen Reißbrett entworfenen Medaillenerwartungen. Auch wenn es an Förderung in späteren Jahren nicht mangeln sollte – der Fußball blieb in der DDR ein Stiefkind.
Ruinöse Experimente
Dabei schien der Anfang hoffnungsvoll. Konnten sich die 1945/46 neu gegründeten Mannschaften zunächst nur regional messen, errang die SG Planitz im K.-O.-System der Landesmeister schon 1948 die erste Ostzonenmeisterschaft. Die Sachsen galten als eine der aussichtsreichsten Formationen ihrer Zeit. Ein Jahr später nahm die überregionale Liga des Deutschen Sportausschusses, die spätere Oberliga, ihren Betrieb auf – 14 Jahre bevor mit der Bundesliga ihr westdeutsches Gegenstück entstand.
«Es gibt zu viele sachunkundige Funktionäre, die glauben, es besser zu wissen.» Janos Gyarmati
Doch wo es sportlich voranging, da packten Funktionäre zuverlässig die Bremsklötze aus. Das Schicksal der SG Planitz steht dafür beispielhaft: Nach dem Titeltriumph gegen Freiimfelde Halle war sie im gesamtdeutschen Viertelfinale gegen den späteren Meister 1. FC Nürnberg gelost. Die sowjetische Besatzungsmacht verweigerte jedoch die Reiseerlaubnis. Als die Fußballvereine ein Jahr später unter die Hoheit von Trägerbetrieben gezwungen wurden, verweigerte Planitz zweimal die Selbstentmachtung. Es nützte nichts: Der informelle Nachfolger des bürgerlichen Erfolgsvereins Planitzer SC hatte sich in die BSG Horch Zwickau und Aktivist Steinkohle Zwickau einzugliedern. Die politisch korrekte Horch-Auswahl wurde 1950 im Dresdner Ostragehege gegen die SG Friedrichstadt – der umbenannte Traditionsclub Dresdner SC – zum Meister gepfiffen. Viele Friedrichstädter Spieler nebst Trainer Helmut Schön verließen daraufhin die DDR.
Dass in diesem Chaos weder Liga noch Nationalelf gedeihen konnten, war auch den Funktionären klar. Nach einem Besuch in Duisburg warnten Vertreter des Deutschen Sportausschusses, «dass der westdeutsche Fußball außerordentlich gut entwickelt ist und es aller Anstrengungen bedarf von unserer Seite, ihm gleichwertig zu sein». Dagegen sorgte sich die SED vor allem um die Kontrolle der Vereine. «Es ist auch nicht zu verkennen, das militaristische und faschistische Kräfte sich in die Sportbewegung einschleichen», lautete bereits im Januar 1947 das Verdikt der Partei-Organisationsabteilung.
In der Nationalelf fielen derweil weniger Tore als Trainer. Nachdem Schön – der neben den Friedrichstädtern auch die Ostzonenmannschaft betreute – in Richtung Westen entschwunden war, führte Fred Schulz die Mannschaft im April 1950 zum 3:1-Sieg gegen die Landesauswahl Sachsen. Später trat er wegen Unstimmigkeiten im Trainerrat zurück und saß ab 1953 bei Werder Bremen auf der Bank. Alfred Kunze nahm 1951 nach zwei verlorenen inoffiziellen Spielen gegen Polen seinen Hut. Willi Oelgardt sollte den Spielern zunächst «patriotisches Denken und Handeln» beibringen. Weil es daran mangelte – allerdings auch wegen Alkoholeskapaden – verzichtete er auf Leistungsträger wie Heinz Satrapa, Helmut Nordhaus, Jochen Müller, Herbert Rappsilber und Fritz Ritter. Immerhin hatten die Athleten als Visitenkarte des sozialistischen deutschen Staates zu agieren – wurde die DDR doch gegen den wütenden Protest des westdeutschen DFB im Juli 1952 in die FIFA aufgenommen.
Dynamo Dresden blieb die Selbständigkeit verwehrt.
Nach ihrem ersten offiziellen Spiel am 21. September 1952 schlichen die DDR-Kicker dennoch mit einem 0:3 vom Warschauer Rasen. In Bukarest reichte es einen Monat später nur für eine 3:1-Niederlage. Auf dem Trainerstuhl folgte bald Hans Siegert, dessen drei Partien mit Niederlagen endeten. Dass in den ersten sechs offiziellen Begegnungen insgesamt 37 Spieler rotierten, die teilweise aus der 2. Liga stammten, mag zu der desaströsen Bilanz beigetragen haben.
Ungarn auf dem Thron
Ein Ausländer sollte es nun richten. Janos Gyarmati, in den 1930er Jahren Spieler beim Serienmeister Ferencvaros Budapest, übernahm 1955 das Zepter. Sein vernichtendes Urteil bei Amtsantritt: «Es gibt zu viele sachunkundige Funktionäre, die glauben, es besser zu wissen, es fehlt an Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Akteuren und Trainern, und die Spieler haben starke konditionelle Mängel.» Der Ungar griff durch, trommelte die Ballartisten jeden Monat zum Lehrgang in Bad Blankenburg zusammen. Vielleicht entscheidender war die Personalauswahl. «Nun zieht man wieder jene bewährten Kräfte heran, die für unsere Nationalmannschaft lange nicht in Frage kamen», notierte die Zeitschrift Fußballwoche. Die Ernte fuhr die DDR-Auswahl in ihrem siebten Spiel, der Premiere unter Gyarmati, ein: Das 3:2 gegen Rumänien markierte den ersten Sieg.

Den Schatten der Politik konnte die Auswahl jedoch nicht entkommen. Deren langer Arm sorgte in der Liga weiterhin für Chaos. Nach wie vor verschwanden Namen und ganze Mannschaften aus sportfernen Gründen, Polizei und Armee nahmen Vereine unter ihre Ägide. Statt der aufgelösten SG Friedrichstadt lief nun die Retortentruppe Volkspolizei Dresden in der Oberliga auf. Als Dynamo Dresden sollte sich die Mannschaft später jedoch zu einem der erfolgreichsten DDR-Klubs entwickeln. Zwischen 1956 und 1960 wurde die Saison nach sowjetischen Vorbild dem Kalenderjahr angeglichen. Für die Nationalauswahl kam die politische Isolation der DDR hinzu – bis 1957 gab es mit Polen, Rumänien, Bulgarien und Indonesien lediglich vier Gegner. Erst durch die Euphorie nach dem westdeutschen WM-Triumph 1954 rang sich die DDR-Führung zur Anmeldung für die Weltmeisterschaft 1958 durch.
Helden aus dem Harz
Vergesst Bayern München! Deutschlands vielleicht erfolgreichste Mannschaft war Eisenhüttenwerk Thale. 1946 begann die Elf den Spielbetrieb in der Kreisklasse Quedlinburg, war nach beispielloser Erfolgskette 1950 Meister von Sachsen-Anhalt und spielte in der folgenden Saison erstklassig. Den größten Triumph feierte der Werksklub am 3. September 1950. Nach einem 4:0-Sieg über Erfurt hielt Thale im Berliner Walter-Ulbricht-Stadion den Pokal in den Händen. Nach dem Absturz in der Saison 1953/54 konnte die mittlerweile in Stahl Thale umfirmierte Mannschaft nie wieder an alte Erfolge anknüpfen. Zu DDR-Zeiten wiederholt in der 2. Liga, spielt sie heute in der Landesliga Nord Sachsen-Anhalt.
Beim Qualifikationsspiel gegen Wales am 19. Mai 1957 registrierten die Vorverkaufsstellen 500.000 Kartenwünsche für den späteren 2:1-Erfolg. Als im Oktober mit der Tschechoslowakei der zweite Qualigegner anreiste, bemühten sich sogar 640.000 Fans um Einlass. 120.000 Zuschauer sollen sich im überfüllten Leipziger Zentralstadion gedrängt haben – bis heute ein gesamtdeutscher Rekord. Mit einer 1:4-Heimniederlage reichte es am Ende nur für den letzten Platz der Gruppe. Gyarmati, vom Kleinkrieg mit den Funktionären ermüdet, warf den Bettel hin. Er trainierte aber später noch Dynamo Berlin in der Oberliga. Die Zeit des Trainerkegelns war jedoch vorbei. Ein weiterer Ungar, Karoly Sos, dominierte das nächste Jahrzehnt. Ab 1961 gelangen ihm in 43 Partien immerhin 19 Siege und zehn Unentschieden. Höhepunkt war olympisches Bronze 1964 mit der formal als gesamtdeutsche Auswahl antretenden DDR-Elf. Doch einen Fahrschein zu Welt- oder Europameisterschaften konnte auch Sos nicht lösen. 1967 ließ er seinen Vertrag auslaufen.
Die Stunde der Klubs
Am Horizont blitzten jedoch Hoffnungsschimmer. In der Oberliga war die Zeit der Wirren zu Ende gegangen. 1958 übernahm mit dem DFV ein eigener Fußballverband die Organisation des Spielbetriebs. 1965 beschloss der Deutsche Turn- und Sportbund (DTSB) als eigentliche Machtinstanz eine grundlegende Reform zur Verbesserung des Leistungsniveaus. Zehn bisherige Fußballsektionen der Sportvereinigungen wurden als eigenständige Klubs (FC) unter professionellen Bedingungen geführt. SG Dynamo Dresden blieb die Selbständigkeit verwehrt, die Elbstädter agierten jedoch faktisch wie ein FC. Diese elf Mannschaften bildeten später das Rückgrat des DDR-Fußballs.

Auch die Nationalmannschaft schien sich langsam zu fangen. Unter dem seit 1967 amtierenden Trainer Harald Seeger musste sie in 15 Partien nur fünf Niederlagen einstecken. Als die DDR am 22. November 1969 nach einem 0:3 gegen Italien jedoch ihre Hoffnungen auf die WM 1970 begraben musste, war Seeger seinen Job los. Der Jenaer Georg Buschner sollte die Mannschaft nun zum Erfolg führen. Dass der damals 45-Jährige sein neues Amt gar nicht antreten wollte, nütze ihm nichts. Doch das Wunder gelang: Mit rigiden Methoden trieb Buschner die DDR-Auswahl zu ihrer Blüte – und wurde am Ende doch mit Schimpf und Schande in die Wüste geschickt.
🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 102.000 Euro!
Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 102.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: